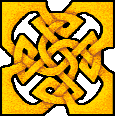Kulturhandbuch 2006
Die
Bretagne (Breiz)
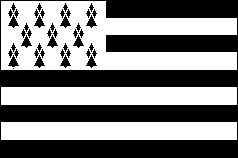 Die
Bretagne ist mit knapp 34.100 km2 Frankreichs größte Halbinsel.
Sie ist in 4 Départements aufgegliedert: Morbihan (56), Finistère (29), Côtes
d’Armor (22) und die Ille-et-Vilaine (35). Die Küstenlinie beträgt etwa
3000 Km. Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne. Die höchste Erhebung ist der
Roc Trevezel mit 384 m. Bis 1964 gehörte das Département „Loire-Atlantique“ mit der Hauptstadt Nantes ebenfalls zur Bretagne, welches seitdem der Nachbarregion
„Pays de la Loire“ angehört.
Die
Bretagne ist mit knapp 34.100 km2 Frankreichs größte Halbinsel.
Sie ist in 4 Départements aufgegliedert: Morbihan (56), Finistère (29), Côtes
d’Armor (22) und die Ille-et-Vilaine (35). Die Küstenlinie beträgt etwa
3000 Km. Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne. Die höchste Erhebung ist der
Roc Trevezel mit 384 m. Bis 1964 gehörte das Département „Loire-Atlantique“ mit der Hauptstadt Nantes ebenfalls zur Bretagne, welches seitdem der Nachbarregion
„Pays de la Loire“ angehört.
Die
bretonische Sprache ist eine eigenständige Sprache, welche von der keltischen
Sprache abgeleitet wurde. Es gibt zudem noch von Département zu Département
Unterschiede in der Aussprache. Gerade in der westlichen Bretagne wird heute
noch sehr viel Bretonisch gesprochen. Dies hat zur Folge, dass die Hinweise
auf den Straßenschildern in französischer und bretonischer Sprache gehalten
sind.
1. Geschichte der
Bretagne
Die MegalithkulturenDie Geschichte der Bretagne, in der es um Menschen
geht, die Zeugnisse hinterließen, beginnt um 4500 vor Christus. Aus dieser
Zeit stammen (nicht nur in der Bretagne) riesige Steindenkmäler, die dieser
Zeit ihren Namen gaben: Megalithen-Epoche.
Wir unterscheiden:
 Menhire = einzeln stehende Steine (bis etwa 10m hoch)
Menhire = einzeln stehende Steine (bis etwa 10m hoch)
Steingehege (Cromlec’hs) = Anordnung einer Gruppe von
Steinen in quadratischer oder runder Form
Steinalleen (Alignements) = Anordnung einer Gruppe von
Steinen in Linie oder parallelen Reihen
Megalithgräber (Dolmen) = Grabkammer und Zugang, die aus
seitlichen Steinplatten mit Steindeckel (Allee couvert) errichtet wurden und
anschließend mit Erde (Tumulus) oder Steinen (Cairn) abgedeckt wurden.
Heute
sind oft nur mehr die Steinelemente erhalten.
Zu dieser Zeit waren die Menschen dieser Region
sesshaft geworden und begannen mit dem Bau von Siedlungen.
Zwei Invasionen beendeten diese Kultur. Um 1850 vor
Christus wanderten Stämme aus Irland und Griechenland in die Bretagne ein und
unterwarfen deren Bevölkerung. Dies gelang ihnen ohne Schwierigkeiten, da sie
im Besitz metallener Waffen waren - damit hielt die Bronzezeit Einzug in der
Bretagne.
In der Folgezeit blühte der Handel der Bretagne mit umliegenden Landstrichen
- vor allem über den Seeweg - auf. Bretonische Äxte wurden Zahlungsmittel in
ganz Europa.
Kelten
Die zweite Invasion brachte ein ganzes Volk in die
Bretagne. Um 700 vor Christus wanderten die Kelten, mit Eisenwaffen
ausgestattet, in mehreren Wellen aus Zentralasien ein und ließen sich im
Westen nieder. Jetzt begann auch hier die Eisenzeit. Damit war die Kultur um
die Megalithen endgültig beendet: Die Kelten brachten eine komplett neue
Kultur und eine eigene Religion mit. Nicht allein ihre besseren Waffen machten
diese Expansion der Kelten möglich - sie hatten auch gelernt, das Pferd zu zähmen
und zum Transportieren zu nutzen. Diese Kelten gaben der Bretagne den Namen
Armorica (Land am Meer). Sie trieben verstärkt Seehandel, prägten eigene Münzen
und beherrschten die Bretagne bis ins 1. Jh. vor Christus.
Trotz alledem sind von den Kelten kaum Spuren bis in unsere Zeit übrig
geblieben. Das mag daran liegen, dass sie wenig Wert auf imposante Architektur
beim Bau ihrer Grabstätten legten oder auch daran, dass ihnen von ihren
Druiden verboten wurde, Schrift zu verwenden.
Römer
Zu der Zeit, als sich die Kelten im Westen Europas
niederließen, wurde am Mittelmeer Rom gegründet (753 v.Chr.). Die Römer
waren es dann später, die die keltische Vorherrschaft in Nordfrankreich
beendeten.  Die sogenannte „Gallorömische Epoche“ beginnt 58 v.Chr. mit
der Eroberung Galliens durch Cäsar. Ganz Galliens??...nein, wir wissen: Ein
Stamm leistete hartnäckig Widerstand - es waren die Veneter, die am Golf von
Morbihan lebten, von dort aus den Zinnhandel mit England kontrollierten, und
die die führende Seemacht Armoricas in dieser Zeit waren. Brutus gelang 56
v.Chr. mit seiner Flotte endlich die Niederschlagung der Veneter. Damit war
ganz Gallien in römischer Hand. Die Bretagne wurde als Armorica
Teil des römischen Gallien.
Die sogenannte „Gallorömische Epoche“ beginnt 58 v.Chr. mit
der Eroberung Galliens durch Cäsar. Ganz Galliens??...nein, wir wissen: Ein
Stamm leistete hartnäckig Widerstand - es waren die Veneter, die am Golf von
Morbihan lebten, von dort aus den Zinnhandel mit England kontrollierten, und
die die führende Seemacht Armoricas in dieser Zeit waren. Brutus gelang 56
v.Chr. mit seiner Flotte endlich die Niederschlagung der Veneter. Damit war
ganz Gallien in römischer Hand. Die Bretagne wurde als Armorica
Teil des römischen Gallien.
Die Römer schufen, wie üblich, ein gutes
Verkehrsnetz und ermöglichten somit den Handel und damit den Aufstieg der
Provinz zu gewissem Wohlstand. Gleichzeitig damit bedeutete dies den
Niedergang der ursprünglichen Kultur. Ganz Frankreich wurde romanisiert, nur
die Bretagne bewahrte Reste ihre eigene keltische Vergangenheit. So überlebte
u.a. die bretonische Sprache.
Inselkelten
Der Zerfall des Römischen Imperiums bescherte der
Bretagne die nächste Einwanderungswelle. Die englische Insel wurde von den
Angeln und den Sachsen besetzt, so dass deren ursprüngliche Einwohner immer
mehr nach Süden ausweichen mussten. Schließlich gelangten sie über den Ärmelkanal
in die Bretagne und gaben ihr auch diesen Namen: Klein-Britannien (Britannia
minor) in Anlehnung an ihre Heimat Groß-Britannien.
Diese nun eingewanderten Briten waren wieder Kelten; sie prägen das Bild des
Landstrichs bis heute: Einige der ersten eingewanderten Priester der Briten
werden heute noch als bretonische Heilige verehrt. Die Inselkelten mischten
sich bald und vollständig mit der ursprünglichen Bevölkerung. Gleichwohl
aber bewahrten diese Inselkelten im Gegensatz zur romanisierten keltischen
Vorbevölkerung ihre Sprache und Kultur, da sie unter anderem noch lange den
Kontakt zu den Britischen Inseln hielten.
Die neuen Kelten breiteten sich nicht sehr weit nach Osten aus; sie ließen
sich hauptsächlich im Westen nieder, wo eine rein bretonische Bevölkerung
entstand, weiter nach Osten hin vermischten sie sich mit der dort lebenden Bevölkerung.
Um 600 gründet König Gradlon das erste Königreich auf bretonischem Boden:
„Cornouaille“ besteht knapp 200 Jahre lang.
Ab dem 5. Jahrhundert versuchten die fränkischen Merowinger, sich die
Bretagne anzueignen, was ihnen allerdings nie richtig gelang. Auch Karl der
Große kam nicht weiter als bis Rennes; er errichtete an der Grenze zu den
Bretonen die sogenannte Bretonische Mark zum Schutz vor deren Übergriffen.
Karls Nachfolger, Ludwig der Fromme, ernennt den Grafen von Vannes, „Nominoë“,
zum Herzog der Bretagne und begeht damit einen entscheidenden Fehler. Nominoë
verweigert die geforderten Tributzahlungen und nutzt im Weiteren die
kurzzeitige Schwäche Frankenreichs aus, die nach dem Tod Ludwig des Frommen
entstand und als Folge dessen das Reich dreigeteilt wurde. Nominoë ruft das Königreich
Bretagne aus. Wichtiges historisches Ereignis in diesem Zusammenhang ist die
Schlacht bei Ballon im Jahr 845, wo Nominoë Karl den Kahlen schlug und eine
Westgrenze der Bretagne etablierte, die im Grunde so bis in die Französische
Revolution erhalten blieb. Unter anderem eroberte er die "Bretonische
Mark".
Zu Beginn des 10. Jahrhunderts fielen die Normannen in der Bretagne ein,
verjagten die Bevölkerung und zerstörten die Klöster. Die Kanalinseln,
bisher bretonisch, gehen verloren. Die Bretagne wurde wieder Herzogtum,
unterlag aber nie der Herrschaft eines fremden Führers.
Alain Barbetorte („mit dem gezwirbelten Bart“), letzter König der
Bretagne, floh 919 nach England, kehrte 937 zurück und vertrieb die Normannen
wieder, bevor sie sich in der Bretagne etabliert hatten. Als Alain Barbetorte
starb, zersplitterte sich die Bretagne immer mehr - einzelne Grafen rangelten
um die Oberherrschaft.
In der Folgezeit geriet die Bretagne zunehmend unter französische
Landeshoheit; sie blieb zwar eigenständiges Herzogtum, jedoch mit einem Führer
an der Spitze, dessen Herzogtitel vom französischen König nicht anerkannt
wurde. Die einzelnen Grafen und Herzöge suchten sich Verbündete von Außen:
In England und Frankreich wurden sie fündig, so fiel 1166 die Bretagne an das
englische Haus Plantagenet, weiter dann Anfang des 13. Jahrhunderts an eine
Nebenlinie der Karpetinger und wurde schließlich 1297 als französisches
Herzogtum bestätigt.
Erbfolgekrieg
1341 starb Jean III., Herzog der Bretagne und
hinterließ keinen Nachfolger. Jetzt geriet auch die Bretagne in den Hundertjährigen
Krieg zwischen England und Frankreich, der 1337 begonnen hatte, nachdem der
letzte der Karpetinger gestorben war und nun sowohl die Engländer als auch
die Valois Anspruch auf den französischen Thron erhoben.
In der Bretagne begann der Bretonische Erbfolgekrieg, bei dem sich Jeanne de
Penthièvre, die Nichte Jeans III., und dessen Halbbruder Jean de Monfort
bekriegten.
Sowohl die Penthièvres als auch die Monforts hatten mächtige Verbündete: Während
die Penthièvres den Klerus, als auch die französische Monarchie hinter sich
wussten (Jeanne war Ehefrau von Charles de Blois, dem Neffen des französischen
Königs), standen auf Seiten der Monforts der bretonische Adel sowie England.
Jean de Monfort wurde 1343 gefangengenommen und kurze Zeit wieder befreit; währenddessen
verteidigte seine Frau, Jeanne la Flamme, Hennebont gegen Charles de Blois.
Französische und englische Truppen griffen in der Folgezeit ins Geschehen
ein. Die Söldner zogen brandschatzend durchs Land, raubten und plünderten,
schwächten den jeweiligen Gegner aber nicht wesentlich. Schließlich siegte
Jean de Monfort am 29.September 1364 bei Auray in einer Entscheidungsschlacht
doch noch über Charles de Blois, der hierbei umkam, und beendete damit den
Erbfolgekrieg. Jean wurde ein halbes Jahr später Herzog der Bretagne.
In der Folge geriet die Bretagne inmitten des weitertobenden Hundertjährigen
Krieges zu Wohlstand. Die Herzöge ließen zum Teil sogar eigene Münzen prägen.
Herrscher dieser Zeit waren u.a. Jean IV le Conquérant, Jean V le Sage,
Pierre II le Simple und Arthur III le Justicier. Franz II., der letzte der
Montforts jedoch macht den entscheidend Schritt, der den Niedergang der selbständigen
Bretagne eröffnet. Frankreich wird zu dieser Zeit kommissarisch von Anne de
Beaujou, die ihren minderjährigen Bruder Karl VIII. vertritt, regiert. Franz
glaubt sie schwach und sich stark genug, Frankreich zu schlagen. Nach der
Schlacht bei St. Aubin allerdings muss er bedingungslos kapitulieren.
Anne de Bretagne
Frankreich lag nach Beendigung des Hundertjährigen
Krieges viel daran, die Bretagne für sich zu gewinnen. So kam Franz'
Niederlage gerade Recht, und so musste er sich verpflichten, seine Tochter,
und künftige bretonische Herrscherin, Anne, nur mit Zustimmung des französischen
Königs zu verheiraten.  Damit war der Anschluss der Bretagne an Frankreich
besiegelt.
Damit war der Anschluss der Bretagne an Frankreich
besiegelt.
Zunächst allerdings heiratete Anne, die zu einer Art Pop-Idol der Bretagne
aufstieg, einen Habsburger: Max von Österreich, der zum Zeitpunkt seiner
Hochzeit aber gerade in Holland Krieg führte. Ziel Max’ war es Frankreich
durch geschicktes Heiraten einzukreisen - Burgund hatte er schon erheiratet.
Anne und Max sahen sich nie.
Charles VIII., 19-jähriger französischer König, forderte auf Anraten seiner
älteren Schwester die Hand Annes zurück - und damit auch die Bretagne. Er
marschierte ins Land ein, belagerte Anne in Rennes und, gezwungen von öffentlichem
Druck, stimmte Anne zu - allerdings nur der Heirat. In dieser Situation
vermittelte auch Papst Innozenz VIII.: Er annullierte den Heiratsvertrag mit
Maximilian; Charles seinerseits löste seine Verlobung mit der Tochter
Maximilians. Die Heirat mit Charles allerdings soll dann in der Tat doch aus
Liebe stattgefunden haben.
Charles starb nach einem häuslichen Unfall mit 28 Jahren; auch keines der
vier Kinder, die beide gemeinsam hatten, überlebte.
Anne, inzwischen 22 Jahre alt, heiratete Charles’ Nachfolger, Ludwig XII. -
wie im Ehevertrag mit Charles festgelegt. Die Bretagne blieb weiterhin
autonom. Anne starb mit 37 Jahren, ihre Tochter Claude erbte das Herzogtum.
Diese heiratete den späteren französischen König Franz I., wogegen sich
Anne zu Lebzeiten eingesetzt hatte. Damit war die Bretagne französisch. Im
Vertrag von Vannes („Traité d’union“) wird die „immerwährende Union
des Landes und des Herzogtums Bretagne mit dem Königreich und der Krone
Frankreichs“ festgelegt.
Französische Provinz
Zwar war das Selbstbewusstsein der Bretonen in der
Folgezeit etwas geknickt, doch beginnt jetzt wiederum ein relativ goldenes
Zeitalter für die nun französische Provinz: Der Überseehandel, die
Tuchproduktion und die Landwirtschaft blühten gewaltig auf. Die Städte und
Gemeinden kamen zu Wohlstand, was sich am deutlichsten an den Bauten aus
dieser Zeit ablesen lässt - vor allem den Kirchen und Kalvarien.
Mitte des 17. Jahrhunderts ging diese Zeit zuende: Ludwig XIV, französischer
König, lag hochverschuldet mit den Niederlanden im Krieg. Um sich weiter zu
finanzieren, erfand er 1675 die „Stempelsteuer“ und entzog der Bretagne außerdem
die Steuerfreiheit auf Salz. Die daraufhin ausbrechenden Aufstände wurden
blutig niedergeschlagen.
Im 18. Jahrhundert machte sich erneut die Lage am Meer für die Bretonen
bezahlt: Brest wurde wichtigster Militärstützpunkt Frankreichs und Nantes
bedeutendster Hafen für den Sklavenhandel.
Französische Revolution
Als in Paris die Bastille gestürmt wurde, darbte
der Bauernstand in der Bretagne; Adel und Klerus beteiligten sich durch
Steuererhöhungen aktiv daran. Somit ist verständlich, dass die Bauern zunächst
auf Seiten der Revolutionäre waren. Die Abgeordneten der Provinz taten sich
zum Club breton zusammen, aus dem später die Jakobiner
hervorgingen.
Als jedoch die Republikaner gegen die Kirche vorgingen, wandte sich die Bevölkerung
von ihnen ab und schlug sich größtenteils auf die Seite der Royalisten,
woraufhin ein blutiger Bürgerkrieg ausbrach.
Der Mobilmachungsbefehl, der im Februar 1793 aus Paris kam und die Einberufung
von 300.000 Bretonen anordnete, wurde Auslöser zur Gründung einer Gruppe,
die sich gegen die Revolution wandte und die sich "Chouans" nannte.
Sowohl Adelige, als auch Geistliche und Bauern fanden sich hier zusammen.
Die zentralistische Revolutionsregierung in Paris - der "Konvent" -
hatte die Bretagne ihrer alten Form beraubt und willkürlich in fünf
Departements zerteilt. Das regte natürlich den Widerstand der Bretonen.
Außerdem waren bereits 1789 alle kirchlichen Güter der Republik einverleibt
worden, was den äußerst religiösen Bretonen und vor allem ihren Geistlichen
ebenfalls nicht schmeckte. Zwar durften die Priester in ihren Ämtern bleiben,
doch mussten sie einen Treueid auf die Republik ablegen. Manche gebärdeten
sich in der Folgezeit auch sehr republikanisch: So wurde auf kirchliche
Initiative z.B. Saint Malo in Port Malo umbenannt - als eine der Maßnahmen,
alles Christliche verschwinden zu lassen.
Die Chouans leisteten den republikanischen Truppen heftigen Widerstand und
verwickelten sie zehn Jahre lang in einen Guerillakrieg. Die Republik, die den
Chouans nicht Herr werden konnte, reagierte mit brutalen Vergeltungsschlägen.
Ein Versuch, Napoleon zu entführen, scheiterte 1804, der letzte Anführer der
Chouans wurde hingerichtet, er wird zu einem der vielen bretonischen
Nationalhelden. Schließlich wurde auch die Bretagne ein fester Teil des
zentralistisch regierten Frankreichs. Allerdings wurde sie von Paris mehr als
nur vernachlässigt. Der Seehandel geriet durch die aufkommende Eisenbahn ins
Hintertreffen, die Industrialisierung im 19. Jahrhundert erreichte die
Bretagne im Wesentlichen nicht. Einzig die Lebensmittelproduktion und als
Folge daraus auch die Schuhindustrie, die das Leder des Viehs verarbeitet,
etablierten sich.
Die Bretagne war wirtschaftlich mehr oder weniger vom Mutterland abgekoppelt -
ein überbevölkertes Agrarland, ohne Ressourcen, dazu ständig geplagt von
Hungersnöten und von Seuchen.
Es ist die Zeit, in der die bis in unser Jahrhundert andauernde Landflucht
einsetzte.
Das 20. Jahrhundert
Im Ersten Weltkrieg wurden bei der französischen
Infanterie Bretonen regelrecht verheizt - 300.000 von ihnen fielen; immerhin
ein Zehntel der bretonischen Bevölkerung.
1919 erklärte der Marquis de l'Estourbeillon mit Zustimmung von Marschall
Foch und den bretonischen Bischöfen die Erneuerung des Traité d’union von
1532 mit der gleichzeitigen Ankündigung, die Bretagne könne sich auf
internationalen Konferenzen eigenständig vertreten.
1930 wird die "Parti national breton" gegründet. Bereits seit Ende
des Weltkriegs verstärkte sich die bretonische Nationalistenbewegung, was
auch in der Gründung des Geheimbundes "Gwenn ha Du" (Name der
bretonischen Flagge) Ausdruck fand. Erste Attentate folgten, in Rennes wurde
ein Denkmal gesprengt, das an den Ergebenheitsschwur der Bretagne erinnerte.
Diese nach Unabhängigkeit strebenden Bretonen erhielten dann plötzlich
unerwartete Unterstützung: Die Nazis marschierten 1940 ein und besetzten das
Land ihrer "keltischen Brüder". Trotz aller entgegengebrachten
Aufmerksamkeiten wollten die meisten Bretonen nicht viel von den Deutschen
wissen. Unter der Regierung von Marschall Pétain wird ein bretonisches
Beratungskommitée gegründet. Viele Bretonen beteiligten sich aber aktiv am -
zumeist im Untergrund ausgetragenen - Kampf gegen die Besatzer.
1944 mussten die Deutschen die Bretagne verlassen, nachdem die Alliierten im
Juni in der Normandie gelandet waren. Ergebnis des Krieges waren viele zum
Teil erheblich zerstörte Städte.
2. Die Bretonische
Sprache
Beim
Bretonischen handelt es sich nicht etwa um die Sprache der ursprünglich in
der Gegend ansässigen keltischen Gallier, sondern um die Sprache britischer
Flüchtlinge von den Britischen Inseln. Das Bretonische ist eng mit den
britannischen Schwestersprachen Kornisch (Cornwall) und Walisisch (Wales)
verwandt. Vor allem mit dem Kornischen teilt sie viele Gemeinsamkeiten.
Gegenseitiges Verständnis ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. In den östlichen
Départements des Verbreitungsgebietes wurde das Bretonische im vergangenen
Jahrhundert immer weiter zurück gedrängt, z.T. zugunsten des Gallo, einem britto-romanischen
Dialekt des Französischen.
Die Sprache genießt keine offizielle Anerkennung von seiten des französischen
Staates. Die Sprache wird von einer starken bretonischen nationalen Bewegung
gefördert. Es gibt eine Reihe von bretonisch-sprachigen Diwan-Schulen. Heute
wird Bretonisch nur noch in wenigen Ausnahmefällen von Kindern als
Muttersprache erlernt. Genaue Zahlen liegen nicht vor. Da die letzten jüngeren
Bretonisch-Sprecher relativ weit verstreut leben, ist mit dem völligen
Aussterben der Sprache in den nächsten 50 Jahren fast sicher zu rechnen.
Obwohl die extrem repressiven Gesetze zur Vernichtung des Bretonischen seit
etwa zwei Jahrzehnten abgeschafft sind, ist die Sprache bereits derartig geschädigt,
dass es keiner weiteren Maßnahmen mehr bedarf, sie endgültig zu vernichten.
Zwar gibt es mehrere Zehntausend Sprecher, die bewusst zum Erhalt des
Bretonischen die Sprache erlernt haben, doch verfügt kaum einer von ihnen über
Kenntnisse, die denen eines Muttersprachlers gleichkommen.
Kleines Sprachlexikon
|
Aber(s):
trichterartige Flußmündung, meist an der Nordwestküste der Bretagne
Alan: (französisch = Alain) St-Alan war Bischof von Quimper
Alignement(s): Steinreihe(n) von Megalithen Allée couverte:
Grabanlage von mehreren hintereinanderliegenden Kammern (Megalithen)
Anna: (französisch = Anne) Schutzpatronin der Bretagne (auch
keltische Göttin Anna - aber auch Mutter der Jungfrau Maria)
Ankou: der Tod
Argoat-Arcoat: Land der Wälder - das Innere Land der Bretagne
Armor - Armorika - Armorique: das Land das vor dem Meer ist,
die Küstenlandschaft
Arzel: (französisch = Armel) St-Armel war ein Mönch
Azenor: die Märtyrerin St-Azénor war die Tochter des Königs
von Brest (6. Jh.)
Azilis: (französisch = Cécile)
Bag: Schiff
Beg: Landzunge
Berchéd oder Brechéd: (französisch = Brigitte) war eine
keltische Göttin und St-Bregait die Schutzpatronin von Irland
Bihan: klein
Biniou: bretonischer Dudelsack
Bocage: geschneitelter Heckenbaum
Bombarde: bretonisches, oboeähnliches Blasinstrument
Braz: groß
Brébran: Hügel, Erhebung
Brendan: St-Brenainn war ein irischer Mönch
Breiz: Bretagne
Brezoneg: das Bretonische
Brug: Heidekraut
Cairn: die aufgeschütteten Steine über einem Megalithgrab
Calvaire: Kreuzigungsgruppe meist aus Stein (bildhauerisch)
geformt
Chouans: bretonischer Widerstandskämpfer (z.Zt. der Revolution
1793, auch gegen Napoleon)
Cidre: Apfelwein
Com, Koum: Talmulde
Côte Sauvage: stark zerklüftete Meeresküste
Crech, Quenech: Höhe
Crêpe: dünner Eierpfannkuchen
Cromlech: Megalithen, die kreis- oder halbkreisförmig gesetzt
sind
Dolmen: dol-toal = Tisch; men = Stein: Steintisch, Megalith-
oder Tischgrab (Kammer aus Steinplatten, die tischartig aufgestützt
sind)
Dour: Wasser
Douar: Erde, Platz
Du: schwarz
Edern: keltischer Gott und walisischer Heiliger
Enclos Paroissial: bretonischer Pfarrhof
Enez: Insel
Erwan, Ewan, Ivon, Youenn, Yeun, Ewen, Iwan, Euzen, Eozen:
französisch = Yves, Yvon
Fanch: französisch Francois
Franseza: französisch Francoise
Galette: gesalzener Buchweizenmehl- Pfannkuchen
Goas, Göaz: Bach
Goulven, Goulchen: St-Goulven war Bischof von Leon
Gurvan: literarischer Ursprung
Gweltaz, Jildaz: (französisch Gildas) St-Gildas war Mönch und
Gründer der Abtei Rhuys
Gwenael: St-Gwenael war Abt von Landevennec
Gwenn: weiß
Gwennog, Vinoc: St-Vinoc war ein bretonischer Fürst
|
Gwilherm,
Gwilhou, Lom, Laou: französisch Guillaume
Haras: Hengstdepot
hen: alt
Hervé: St-Hervé war der Gründer der Abtei Lanhouarneau
hir: lang
Ilis: Kirche
Jakez: französisch Jacques
Jildaz, Gweltaz: (französisch Gildas) St-Gildas, Mönch und Gründer
der Abtei Rhuys
Jos, Job, Jef: französisch Josef
Judikael, Jezekel, Izikel, Juhel, Joel: St-Judikael, König der
Bretagne
Kaer: schön
Kaourintin,
Kaourantin: (französisch Corentin) St-Corentin war erster Bischof von
Quimper
Katell: französisch Cathérine
Kemper: Zusammenfluß
Ker: Haus, Dorf
Korrigan(s): Zwerg(e)
Koz: alt
Lan, lann: Kirche, Kloster, geweihtes Land
Lec'h: kleiner regelmäßiger Menhir
Loc: geheiligter Ort, Einsiedelei
Loeiz: französisch Louis
mad: gut
Malo:St-Mac-Law, Gefährte von St-Bredan, Bischof von Alet
mam: Mutter
Maodez: St-Maodez, Mönch aus Irland
Marc'h: Pferd
Marc'harid, Gaid, Gaud: französisch Marguerite
Mari, Maria, Mai: französisch Marie
Marzin: französisch Martin
Mazé, Mazo, Maho, Mahé: französisch Mathieu
Men: Stein (Menhir = Langstein)
Megalith: Großstein
Menez: Berg
Menhir: stehende Megalith-Steinsäule
meur: groß, ausgedehnt
Méven, Meen, Min: französisch = Méven
Mor: Meer
Noz: Nacht
Paludier: Meersalinenarbeiter
Pays gallo: obere Bretagne, in der nicht mehr Bretonisch
gesprochen wird
Pardon: Heiligenfest mit Prozession, auch Wallfahrt
Penn, pen: Kopf, Landzunge, Kap, Ende
Plou, pleu, plé, plo, ploe: Pfarrei
Porz: Hafen
Raz: Engpaß
Roc'h: Felsen
Ros: Hügel
Sarrasin, sarrazin: Buchweizen, war früher eine bedeutende
Getreideart in der Bretagne
Ster: Fluss
Stivell: Quelle, Fontäne
Trez: Sand
Tremeur: St-Tremeur, Märtyrer
Triphine, Trephine: Ste. Triphine, Märtyrerin
Tristan: Sagenheld
Tro: Turm
Troménie: Prozession in Locronan zu Ehren des hl. Ronan
Tudal, Tual, Tugdual: St-Tudal, Gründer des Bistums Tréguier
Tumulus: Hügelgrab, Aufschüttung aus Erde über einem
Megalith-Grab
Ty, ti: Haus
Yann: französisch Jean
yen: kalt
|
Aussprache
- ch wie dt. sch
- c'h wie dt. ch in Bach
- e wie ee in Beeren
- ê wie ä in Bären
- eu wie dt. ö
- g wie dt. g (nie wie in Regie)
- gn wie gn in Champagner
- ilh etwa wie ij
- j wie stimmhaftes sch (j in Journal)
- n wie n, ein vorausgehender Vokal wird jedoch nasaliert
- ñ wird selbst nicht ausgesprochen, nasaliert aber den vorausgehenden
Vokal
- ou wie dt. u, bisweilen wie engl. w
- u wie dt. ü
- v wie dt. w, am Wortende wie dt. u
- w wie engl. w
- y wie dt. j
- z wie stimmhaftes dt. s in reisen
3. Schiffskanäle in der
Bretagne
Der
englischen Marine und ihrer Drohung an die französische Küstenschifffahrt
ist es zu verdanken, dass ein Kanal mitten durch die Bretagne führt.  Der Bau
wurde 1811 unter Napoleon I.
begonnen, aber mit dem Fall des Kaisers bei Waterloo fiel auch der Kanal. 1822
wurde die Kanalgesellschaft der Bretagne gegründet, der Bau begann erneut,
und 1836 wurden 385 km Wasserweg eröffnet, der mit 238 Schleusen einen Höhenunterschied
von insgesamt 555 m bewältigt. Napoleon
III. weihte 1858 bei Chateaulin
eine Meeresschleuse ein, 1875 wurde der Kanal vertieft und ließ größere
Schiffe zu. Leider bedeutete dies nicht auch mehr Fracht: In den 1860er Jahren
hatte man mit 40.000 Tonnen die höchste jährliche Frachtrate erreicht; bis
1880 war sie wieder auf 10.000 Tonnen geschrumpft. Die Wasserstraße erlebte
in den späten 90er Jahren des 19. Jh. einen Aufschwung mit über 30.000
Tonnen jährlich (hauptsächlich Dünger für die Landwirtschaft). So nach und
nach überwog jedoch der Straßen- und Schienentransport und beschleunigte den
Niedergang des Kanalfrachtverkehrs. Den letzten Schlag versetzte ihm ein
hydroelektrischer Damm bei Guerledam
(1928). Er teilte den Kanal in den kleineren Finistere-Canal
und das größere östliche Netz; die beiden Wasserwege sind zwischen Pontivy
und Port Carhaix unbefahrbar.
Der Bau
wurde 1811 unter Napoleon I.
begonnen, aber mit dem Fall des Kaisers bei Waterloo fiel auch der Kanal. 1822
wurde die Kanalgesellschaft der Bretagne gegründet, der Bau begann erneut,
und 1836 wurden 385 km Wasserweg eröffnet, der mit 238 Schleusen einen Höhenunterschied
von insgesamt 555 m bewältigt. Napoleon
III. weihte 1858 bei Chateaulin
eine Meeresschleuse ein, 1875 wurde der Kanal vertieft und ließ größere
Schiffe zu. Leider bedeutete dies nicht auch mehr Fracht: In den 1860er Jahren
hatte man mit 40.000 Tonnen die höchste jährliche Frachtrate erreicht; bis
1880 war sie wieder auf 10.000 Tonnen geschrumpft. Die Wasserstraße erlebte
in den späten 90er Jahren des 19. Jh. einen Aufschwung mit über 30.000
Tonnen jährlich (hauptsächlich Dünger für die Landwirtschaft). So nach und
nach überwog jedoch der Straßen- und Schienentransport und beschleunigte den
Niedergang des Kanalfrachtverkehrs. Den letzten Schlag versetzte ihm ein
hydroelektrischer Damm bei Guerledam
(1928). Er teilte den Kanal in den kleineren Finistere-Canal
und das größere östliche Netz; die beiden Wasserwege sind zwischen Pontivy
und Port Carhaix unbefahrbar.
3.1
Der Nantes-Brest-Kanal
Der 205
km lange Kanal verläuft mit seinen 107 Schleusen nach Norden am Fluss Erdre
und entlang der kanalisierten Flüsse Isac und Oust nach Pontivy, bevor er nach Süden auf den Blavet zu fließt und bei Lorient an
der Biskaya endet. Durch den Zusammenfluss mit der Vilaine
bei Redon kann man auch nach Norden über Rennes
nach Dinan und
in südlicher Richtung nach Arzal fahren, wo man den Atlantischen Ozean
erreicht. Eine Verbindung mit dem westlichen Teil des Kanals (Finistère-Kanal)
bei Brest ist für Motorboote derzeit nicht möglich. Der Wasserweg führt
seine Besucher durch eine der schönsten Gegenden der Bretagne. Die
Fahrtbedingungen variieren wie die Landschaft: Der seegleiche Erdre führt
manchmal raue Wasser, manchmal tummeln sich dort Rotschwänzchen; der enge
Kanal (oder Fluss) schlängelt sich durch kleine Ortschaften; der
Blavet
fließt an Feldern vorbei; und das Gezeitenstück unterhalb von Hennebont
ist nur etwas für erfahrene Schiffer.
Von Nort-sur-Erdre nach Blain
Nort-sur-Erdre
war ein wichtiger Industriehafen. Die Fabriken sind heute geschlossen, die
Lastkähne verschwunden und dennoch hat der kleine Hafen noch immer einen
unbestreitbaren Charme.
Nach der ersten Kanalschleuse, 2,
Quiheix, fühlt
man sich fast schon einsam: bis Blain gibt es kaum
Häuser. Der Scheitelpunkt ist bei der Ecluse 7, le Pas d'Heric,
erreicht, 8 km weiter beginnt bei der nächsten Schleuse das Gefälle Richtung
Redon.
Von Blain
nach GuenruetBei
der Anfahrt auf Blain
sieht man links das Chateau de Blain (15. Jh.), und in der Stadt findet der
hungrige, durstige oder ermüdete Seemann alles, was er braucht.
Der Fluss Isac fließt in den Kanal hinein und
wieder heraus, dadurch entstehen eine Reihe ruhiger Seitenarme zum Ankern,
Schwimmen oder einfach zum Faulenzen.
Die Strecke zwischen den Ecluses 16, Melneuf, und 17,
Bellions, ist 23 km lang, schleusenfrei, mit einigen
lohnenswerten Orten zum Anhalten. Nach der zweiten Flussbiegung
(Flusskilometer 70) sieht man rechts das Chateau Carheil aus dem Jahr
1659 inmitten eines 80 ha großen Parks. Von März bis September gibt es Führungen,
mittwochs und samstags sogar abends bei Kerzenlicht.
Von Guenruet
nach RedonDie
Kirche in Guenrouet enthält wunderbare bemalte Glasfenster aus der
Nachkriegszeit. Von Pont-Miny
(Flusskilometer 83), ist Fégréac weniger als 4 km
entfernt. Attraktionen sind unter anderem alte Häuser und ein Kalvarienberg
aus dem 15. Jh. Diese kirchlichen Monumente sind nicht ungewohnt in der
Bretagne. Viele wurden im späten 16. Jh. errichtet, um die Pest abzuwehren,
oder später, um dafür zu danken, dass man von ihr verschont wurde. Obwohl
etliche von ihnen recht groß sind und von namhaften Künstlern geschaffen
wurden, ist doch die Form immer dieselbe: Stationen aus dem Leben der Jungfrau
und dem Leben Christi. Sie beginnen mit der Verkündigung und setzen sich fort
über die göttliche Heimsuchung, die Geburt Christi und so fort bis zur
Auferstehung und zur Himmelfahrt. Bevor das gemeine Volk lesen und schreiben
konnte, benutzten die Priester die Kalvarien als Lehrmittel.
Von Redon
nach La GacillyRedon ist eine charmante Stadt mit
vielen Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Nach dem Verlassen von Redon fährt man durch eine
gerade, in den Felsen gehauene Strecke, von links mündet der Oust ein. Wie
der Isac
fließt er mehrmals ein und aus und schafft so versteckte Nischen. Vor der
Durchfahrt durch Ecluse 19, Painfaut, ist ein
Abstecher (halber Tag) von 9 km den Fluss Aff hinauf
nach La Gacilly zu empfehlen. Es gibt hier
keine Schleusen, aber folgen Sie genau den Markierungen: Der Aff
beginnt mit Marschland, und der Fluss ist mit Schilf eingesäumt. Auf der
linken Seite nach der Sour-Mac-Brücke
steht ein kleines Chateau; dann verengt sich der Kanal erheblich, und die Bäume
stehen dicht am Ufer; das ist ein seltener Anblick. La
Gacilly taucht völlig unerwartet auf. Ab der modernen Brücke,
die das Ende der Befahrbarkeit bedeutet, findet man an allen Gebäuden bei der
Brücke in jeder Ecke rote und rosa Blumen. Lederarbeiter, Glasbläser, Töpfer,
Juweliere, die mit Halbedelsteinen arbeiten, und Eisengießer sorgen für eine
große handwerkliche Vielfalt in einer überraschend untouristischen Stadt.
Von La
Gacilly nach Malestroit
Wieder
auf dem Kanal fährt man 6 km eine gerade Strecke bis zu einer scharfen
Rechtsbiegung des Flusses. St-Martin-sur-Oust
liegt ungefähr eine Meile entfernt von der Acht-Bogen-Brücke
oberhalb der Ecluse
21, Gueslin. Rochefort-en-Terre ist etwas über 9 km von der Brücke entfernt (wenn keine
Taxis vorhanden, mit dem Fahrrad fahren). Das Schloss ist im Juni und Juli täglich
geöffnet. Es sind nur Mauerausschnitte, Turmruinen und einige unterirdische Gänge
übrig geblieben, aber das Museum sowie der Ausblick auf das Gueuzon-Tal von der Terrasse aus sind interessant. In
mehreren Straßen gibt es Häuser aus dem 16. und 17. Jh., Notre
Dame de la Tronchaye stammt aus dem 12. Jh. mit Ergänzungen
aus dem 15. und 16. Jh. Besonderheiten im Innern sind unter anderem
schmiedeeiserne Gitter und ein Renaissance-Altar. Die Statue der Frau von La Tronchaye
wird in hohen Ehren gehalten; man fand sie in einem Baum, wo sie angeblich
schon Jahrhunderte lang vor der Normanneninvasion versteckt lag. Am ersten
Sonntag nach dem 15. August ist sie der Gegenstand einer jährlichen
Prozession. Die Vergebungsfeier oder Wallfahrt ist eine weitere bretonische
Tradition; sie finden, von einigen Ausnahmen abgesehen, von Mai bis Ende
September statt, beziehen sich meistens auf einen bestimmten Heiligen, dem die
Gläubigen ihre Anliegen anvertrauen. Alles erscheint im Sonntagsstaat,
verbringt den Tag im Gebet, und der Höhepunkt des Tages ist eine Prozession.
Heute wird dem religiösen Teil in den frühen Morgenstunden nachgegangen, und
weltliche Vergnügungen (und Handel) füllen den Rest des Tages. Wer bretonische
Trachten sehen will, wählt dazu am besten eine
Vergebungsfeier.
In
Malestroit bietet die Anlegestelle
jeglichen Service für den
durchfahrenden Schiffer. Jeden Donnerstag ist Markttag, und eine gute Auswahl
gotischer und Renaissance-Häuser hat überlebt. Eines an der Place Bouffay
ist mit einer Schnitzerei besonderer Art verziert: Ein Bürger im Nachthemd
schlägt gerade seine Frau. Diese fantasievollen Schnitzereien setzen sich an
der Kirche St.-Giles
fort; eine stellt einen Akrobaten in der Luft dar, und die Tiere einer anderen
sind eher abstrakt gehalten. Das Musée de la Resistance,
7 km von Malestroit entfernt, ist der
Teilnahme der Bretagne am Zweiten Weltkrieg gewidmet. Es enthält eine breite
Palette von Ausstellungsstücken, darunter Zeitungen, Rationenbücher,
Kleidung, Uniformen von beiden Seiten und einen ausgezeichneten Film über den
Krieg vom Anfang bis zu seinem Ende.
Von
Malestroit nach Josselin
Nach
der Brücke bei Le Roc-St.-André
und einer scharfen Rechtskurve folgt das Chateau Crévy an
der nächsten Biegung.
Montertelot hinterlässt
einen etwas blassen Eindruck, obwohl es dort viele gut erhaltene Fachwerkhäuser
gibt und die Kirche am Hafen Teile aus dem 12. Jh. beinhaltet.
Ploermel, einst Sitz der Herzöge der Bretagne, liegt 7 km
weit entfernt. Die Stadt wurde im 6. Jh. von St.-Armel
gegründet. Die humorvollen Schnitzereien am Westportal der Kirche sind
einzigartig, leider braucht man einen Feldstecher, um alles erkennen zu können.
Die zurückgesetzten, bemalten Glasfenster stammen aus dem 16. und 17. Jh.; in
der Kapelle sind weiße Marmorstatuen von zwei Herzögen der Bretagne aus dem
14. Jh., Jean
II. und Jean III. Sehen Sie sich auch
die Fachwerkhäuser in der Rue Beaumanoir an. Wer einen
Sinn für neuere Geschichte hat, dem gefällt sicher die Statue von Dr.
Guérin, dem Erfinder von Baumwollspezialverbänden. Sie
wurden zum ersten Mal im Deutsch-Französischen Krieg angewendet und retteten
manchem das Leben.
Einer
der besser bekannten Zusammenstöße in der Bretagne war die Schlacht
der Dreißig, die sich 1351 auf einer Heide auf halbem Weg
zwischen Ploermel und Josselin
ereignete; (mit dem Fahrrad 3 km von der Brücke bei St.-Gobrien entfernt;
Steinmarkierung an der Brücke Nr. 24 beachten). In der Mitte des 14. Jh., als
der Erbfolgekrieg seinen Höhepunkt erreicht hatte, war Josselin
in der Hand der königlichen französischen Armee. Ihre Gegner, die von Montfort,
hatten ihren Stützpunkt in Ploermel. Nach einer Reihe von
Schlachten ohne entscheidenden Ausgang sollten schließlich je 30 der besten Männer
auf beiden Seiten so lange im Nahkampf verweilen, bis der letzte aufrecht
stehende Mann die Siegerseite bestimmen würde. Am
Ende eines langen Märztages gewann Josselin.
Der
Kanal setzt sich auf seiner halbverlassenen Route bis zum Chateau von Josselin
fort, einem der wenigen Beispiele, bei denen die Realität die Vorahnung
voll bestätigt. Wir nähern uns vom Wasser her, und zunächst sehen wir nur
die konischen Türme über den Bäumen. Danach tauchen die riesigen
bretonischen Mauem aus grauem Stein auf, als ob sie sich jedem Eindringling in
den Weg stellen wollten; die kleineren, unwichtigeren Gebäude spitzeln hinter
dem Schloss hervor wie ein Kind hinter dem Rock seiner Mutter. Der Bau der
ersten Festung auf diesem Platz wurde um das Jahr 1000 von Guthenoc
de Porhort begonnen, aber sein Sohn Josselin
stellte sie fertig und gab Schloss und Stadt seinen Namen. Einer seiner eher
extravaganten Besitzer war Olivier de Clisson, dessen
Ratgeber und Vorbild seine Mutter war. De Clissons Vater
war wegen Verrats an den Franzosen im Erbfolgekrieg enthauptet worden. Als man
seinen Kopf auf den Mauem des Schlosses bei Nantes aufsteckte, nahm diese
bemerkenswerte Frau ihre Kinder zur Besichtigung mit und sagte: "Sehen
wir zu, dass die Bastarde, die das getan haben, in unsere Hände fallen."
Jeanne
de Belleville versenkte daraufhin jedes Schiff, das ihren Weg
kreuzte, und zerstörte sechs Schlösser, deren Besitzer das Unglück gehabt
hatten, mit der französischen Seite zu sympathisieren. Im Verlauf dieser
Ereignisse machte sie aus ihrem Sohn Olivier einen harten Mann. Er diente mit
Auszeichnung in der englischen und später, unter Karl
V., in der französischen Armee. Der große Bertrand du Guesclin
wurde sein Freund; nach dessen Tod stieg De Clisson zum
Polizeichef Frankreichs auf. 1370 heiratete er Marguérite de Rohan
und wurde somit Herr über Schloss Josselin, das er mit Mauern und Türmen
versehen ließ und zu einem der wichtigsten inländischen Stützpunkte der
Bretagne machte. Leider verlor sein Schirmherr, Karl VI.,
den Verstand, und der alte Krieger wurde von seinen Gegnern aus dem
Erbfolgekrieg auf die Festung am Fluss verbannt, wo er 1407 starb. Weniger als
100 Jahre später zerstörte der damalige Herzog der Bretagne, Francois
II., das Schloss, um Jean II. de Rohan
für seine Königsloyalität zu bestrafen. Als Anne, die Tochter Francois II.,
Königin von Frankreich wurde, gab sie Jean II. als Akt der Versöhnung das
Geld für den Wiederaufbau. Jean war klug genug, Dankbarkeit zu zeigen: Suchen
Sie nach dem schön verzierten Buchstaben "A" (Anne) an jedem gut
sichtbaren Teil des Bauwerks. Nach seiner Fertigstellung war das Schloss die
Verkörperung des Familienmottos "Ich kann nicht König sein. Ich
verachte es, ein Prinz zu sein. Ich bin ein Rohan."
Dieses Veredelungsprogramm erlitt 1629 jedoch wieder einen schweren Schlag,
als fünf Türme zerstört wurden. Der Urheber war Richelieu - wieder
einmal -, denn ein anderer Rohan (Henri) führte
die Hugenotten an, was dem Premierminister Ludwigs
XIII. stark missfiel. Durch alle Schwierigkeiten hindurch ist
das Schloss jedoch im Besitz der Familie Rohan geblieben. Die letzte größere
Renovierung wurde Ende des 19. Jh. vorgenommen.
Die
Basilika
Notre Dame du Roncier (Unsere Frau vom Dornbusch) hält jeden
8. September eine weithin bekannte Vergebungsfeier, das Pardon,
ab. Der Name der Kirche leitet sich von einer Begebenheit aus dem
9. Jh. her, als ein Bauer bei der Arbeit auf dem Feld eine Statue der Jungfrau
Maria fand und sie in seinem Haus aufstellte. Der Statue gefiel es dort
offensichtlich nicht, denn sie kehrte auf das Feld zurück. Dieser Vorgang
wiederholte sich mehrere Male. Schließlich baute man im 11. Jh. am Fundort
eine Kirche für die Jungfrau. Aus unbekanntem Grund verbrannte die Statue
1793, und es verbleiben nur einige Fragmente, die in einem Reliquienkästchen
im Heiligtum ausgestellt sind. Olivier
de Clisson und seine Frau Marguerite de Rohan
liegen hier ebenfalls begraben; Fotobegeisterte sollten den ungewöhnlichen
Ausblick vom Schlossturm aus genießen.
Vorübergehende Anlegeplätze gibt es beim Schloss, dort kann man auch Wasser
zapfen, aber keinen Treibstoff. Die Atmosphäre der Stadt ist angenehm, es
gibt mehrere Restaurants und Geschäfte.
3.2
Die Vilaine
Die
Vilaine war einer
der ersten Wasserwege Europas, der mit Teich- oder Kanalschleusen ausgestattet
wurde; schon ab 1550 war sie von der Biskaya bis nach Rennes
befahrbar. Etwa in der Mitte des 18. Jh. entstanden Pläne für einen Kanal
von Rennes
nach Dinan, die jedoch von der Französischen Revolution
untergraben wurden. 1890, hundert Jahre später, wurde die Schifffahrt
zwischen dem Ärmelkanal und dem Atlantik möglich.
Der Fluss verdient diesen Namen eigentlich nicht; er bedeutet "hässlich"
oder "widerlich". Es ist ein sehr hübscher Wasserweg mit langen,
angenehmen Strecken. Vielleicht rührt der Name ursprünglich von den Tücken
der Gezeiten, von seichtem Gewässer und den Felsen im Flussbett, die so
manches Schiff sinken ließen. Trotz des Schleusenbaus ist die Vilaine immer
noch ein Fluss, und die Navigationsmarkierungen sollten peinlichst genau
befolgt werden.
Von Redon
nach Messac
In
Redon kreuzen Sie
den Nantes-Brest-Kanal. Die neueren Stadtviertel von Redon
liegen nördlich des Nantes-Kanals, die älteren auf einer kleinen Insel
zwischen der Vilaine und dem Hafen (alle Service-Anlagen vorhanden). Im älteren
Teil gibt es Straßen mit Pflastersteinen, alte Gebäude, die interessanteren
Restaurants und genügend Creperies.
Die Stadt wurde ursprünglich als Benediktinerabtei im 9. Jh. gegründet; sie
florierte und wurde im 14. Jh. mit Mauern versehen (einige Überreste kann man
in der Nähe des Kai St.-Jacques sehen). Die Abteikirche St.-Sauveur
sieht merkwürdig aus: wegen eines Feuers von 1782 ist der gotische Turm von
der Kirche abgesetzt. Die Kirche steht an der Place de I'Hotel de Ville; Cardinal
Richelieu ließ als verwaltender Abt den fein gearbeiteten
Hochaltar errichten.
Bei Beslé kann man in dem attraktiven Hotel du Port zu
einem vernünftigen Preis essen; bergauf geht man in die Stadt und zum
Einkaufen.
In Port de Roche findet sich eine interessante Eisenbrücke mit den Siegeln
von Napoleon und Eugenie, die ursprünglich bei der Weltausstellung in Paris
gestanden hat. Ausflugsmöglichkeit zum 2km entfernten Ort Langon mit seinen
28 aneinandergereihten Menhiren, genannt „Demoiselles de Langon“.
Und wieder verändert sich die Landschaft: Zu beiden Seiten ziehen sich Wälder
entlang des Flusses, Le Bois de Baron und Le Bois de Boeuvre; auf den
Felsen wachsen Pinien, Kastanien und Birken. Die Städte liegen etwas näher
am Fluss. Bei Malôn ist die erste Schleuse auf der
Vilaine erreicht.
Messac hat einen Bootsverleih und einen neuen Anlegeplatz,
auf dem man viele Service-Einrichtungen wie z.B. einen Kran, eine Rampe,
Treibstoff (Diesel und Normal) und Reparaturdocks vorfindet. Für Einkäufe
legen Sie am Steinkai bei der Brücke unterhalb der Ecluse 12, Guipry, an. Bei
der Schleuse befindet
sich die kleine Kapelle Notre Dame de Bon-Port. Der Graf
von Treguilly, dessen riesige Salzvorräte von einer ungewöhnlich
hohen Flut bedroht waren, ließ die Kirche 1644 errichten, um für die
Verschonung seines wertvollen Besitzes zu danken. Bevor die Vilaine
zum Kanal ausgebaut wurde, konnte man flussaufwärts nur bis Guipry
fahren, das für den Salzhandel im 17. Jh. wichtig war.
Das Salz wurde bei St.-Nazaire gewonnen und mit dem
Schiff nach Guipry gebracht, wo eine Steuer, die „gabelle“,
erhoben wurde. Da jeder Untertan jedes Jahr eine bestimmte Menge
Salz kaufen musste, waren die Steuern erheblich. Die Männer, die sie
eintrieben, hießen „Gabelous“.
Von Messac nach Rennes
In Bourg-des-Comptes findet man Einkaufsmöglichkeiten
nur im Ort (800m oberhalb des Flusses).
Beim Parc
Naturel de Boel verläuft der Fluss zwischen hohen Felsen;
Pappel- und Weidenzweige hängen über dem Wasser, und an den Wochenenden drängen
sich hier die Besucher. Deswegen haben zwischen den Ecluses
8, Bouexiere und 7, Boel, viele Restaurants aufgemacht, darunter das „Le
Vieu Moulin de Boel“. Außergewöhnlich schön ist die Staumauer, die bis
zur alten Mühle am gegenüberliegenden Ufer verläuft. Die Mühle, deren
bergseitige Mauer die Form eines Schiffsschnabel hat, um dem Hochwasser der
Vilaine Stand zu halten, ist seit 1935 nicht mehr in Betrieb.
In Pont-Rean beeindruckt eine Steinbrücke mit acht Bögen aus dem Jahre 1767.
Früher stand hier
eine alte römische
Brücke aus Stein und Holz. Im
Mittelalter verhalf der Brückenzoll dem Ort zu wirtschaftlicher Blüte. Es
gibt hier eine Bootsstation mit gutem Service. Das Passieren der Steinbrücke
ist etwas schwierig. Oberhalb von Pont-Rean
muss man mehrere Inseln umfahren.
Rennes
Durchfahren
Sie das Industriegebiet von Rennes so
schnell Sie können! Gleich unterhalb der Ecluse 1, Mail, die in den Canal
d’Ille-et-Rance führt, befindet sich die Anlegestelle, von der aus man alle
Sehenswürdigkeiten von Rennes in fünf Minuten erreicht. Der Stadthafen liegt
in einer angenehmen Umgebung, man kann dort Wasser tanken.
Rennes
ist wirklich eine Unterbrechung wert: Fußgängerzonen, Restaurants in Hülle
und Fülle (auf einem Platz bei der Kathedrale geben sich Vietnamesen,
Italiener und Franzosen die Hand) und eine Markthalle an der Rue de Nemours. Man findet dort eine
große Auswahl an Frischfleisch, Gemüse und Käse.
Die
Geschichte von Rennes reicht weit zurück: Schon die
Kelten haben hier Häuser errichtet, und die Römer haben sie mit Mauem
umstellt. 1213 wurde es die Hauptstadt der Bretagne; 1720 verwüstete ein
Feuer die Stadt größtenteils, aber sie wurde wieder aufgebaut und überlebte
die meisten der Ausschreitungen während der Revolution.
Das moderne Rennes hat keine Ähnlichkeit mehr mit seiner verschlafenen
Vergangenheit. Zwar sind noch viele Gebäude im klassischen Stil des 18. Jh.
vorhanden, aber die Stadt hat heute zwei Universitäten,
und hier sind wichtige Unternehmen der französischen Elektronikindustrie und
des Fernmeldewesens angesiedelt.
Lange
rivalisierte die Stadt mit Nantes um den Titel "Hauptstadt"; schließlich
wurde er Rennes zuerkannt, da es wegen seiner Binnenmärkte leichter zu
verteidigen war. Die Herzöge hätten es vorgezogen, in ihrer Festung in
Nantes zu leben, aber sie kamen doch zu ihrer feierlichen Einsetzung nach
Rennes. Die Eheschließung zwischen Herzogin
Anne und Karl VIII. von Frankreich
(1491) verband nicht nur zwei Menschen, sondern führte auch zur Vereinigung
der Bretagne mit Frankreich. Die verlorene Unabhängigkeit bedeutete jedoch
nicht auch den Verlust der Privilegien: 1561 wurde in Rennes das Parlament
einberufen, das - abgesehen von einer kurzen Zwischenperiode im 17. Jh. - bis
zur Revolution eigenständig blieb und seine eigenen Gesetze erließ.
In
Rennes machte Bertrand du Guesclin sich erstmals einen Namen. 1337 fand
hier ein Turnier statt, an dem Du Guesclin teilnehmen wollte; er wurde jedoch
von seiner Familie abgehalten. Schließlich brachte er einen seiner Cousins
aus Rennes soweit, ihm Pferd und Rüstung zu leihen und nahm unerkannt teil.
Er hob mehrere Gegner aus dem Sattel, gelangte so zu Berühmtheit, später zu
Reichtum und starb als Held.
Der
Brand
von 1720 richtete in Rennes einen solch
enormen Schaden an, dass Ludwig XV. die
gewaltigen Mittel für den Wiederaufbau zur Verfügung stellte. Jacques
Gabriel wurde als Architekt verpflichtet und gab der Stadt im
18. Jh. das Gesicht, das sie heute zeigt. In den Straßen um die Kathedrale
kann man noch einige wenige Fachwerkhäuser aus dem 15. und 16. Jh. finden.
Sehen
Sie auch einmal in den Hof des Hotel du Blossac in der Rue
de Chapitre; hier gibt es eine hübsche Wendeltreppe. Eines
der schönsten Häuser ist an der Rue St.-Guillaume
3; die Place de la Lices war der Schauplatz jenes Turniers, in
dem Du Guesclin triumphierte.
Die
Kathedrale St.-Pierre (1844) ist die dritte auf
ihrem Platz. Der wundervolle Altar wird von dem reich verzierten Innenraum
beinahe noch in den Schatten gestellt. Die Glasmalereien aus dem 16. Jh. von
St.-Germain stellen Szenen aus dem Leben der Heiligen dar. Die Kapelle St.-Sauveur
von Unserer Frau der Wunder ist jenem Heiligen gewidmet, der
1357 Rennes von den Engländern befreite.
Von außen
ist das ehemalige Parlamentsgebäude der Bretagne nicht imponierend. Der
Architekt des Pariser Palais du Luxembourg, Salomon de Brosse,
war mit dem Bau beauftragt (Bauzeit: 1618-1655; heute Gerichtsgebäude ). Von
hier aus regierten über 100 Vertreter der bretonischen Aristokratie die
Provinz, die trotz der Tatsache, dass ihre Sitze gekauft waren (für etwas
weniger als 1000 Dollar in heutiger Währung), in hohen Ehren standen. Das Gebäude
wurde zwar in dem Brand beschädigt, jedoch nicht zerstört, und Gabriel
restaurierte es. Die mit Säulen ausgestattete Salle des Gros Piliers
kommt gleich vor der Salle des Pas Perdus. Ihre mit Holz
vertäfelte Deckenwölbung ist in Gold und Blau ausgemalt und trägt das
Wappen der Bretagne und Frankreichs in der Mitte. Zum Obergeschoß führt ein
doppelter Aufgang; Gemälde einiger der besten Künstler aus der Zeit Ludwigs
XV. zieren die Wände. Der beeindruckendste Raum ist die Grande
Chambre (Großes Zimmer), in dem ehemals das Parlament tagte.
Er ist über 20 m lang, 10 m breit und 7 m hoch; die getäfelte Decke und
andere Holzarbeiten sind atemberaubend. An den Wänden hängen 10 Gobelins mit
Szenen aus der Geschichte der Bretagne, deren Herstellung 24 Jahre dauerte.
Auf den Besucherrängen hat so manche historische Persönlichkeit gesessen,
unter anderen die berühmte Briefschreiberin Madame de Sevigne.
Im Gegensatz dazu erscheint der Bankettsaal des barocken Rathauses fast
einfach, das mit seiner großen Uhr, "Le Gros",
ebenfalls von Gabriel geschaffen wurde.
4. Bretagne-Rundfahrt Etappe 1
4.1
Der Wald von Brocéliande und der Zauberer Merlin
Brocéliande
ist der Legendenname des
derzeitigen Waldes von Paimpont, südwestlich von Rennes. Es handelt sich
hierbei jedoch nur noch um Reste eines riesigen Waldgebietes, das im
Mittelalter das Herzen der Halbinsel einnahm und die Heimat zahlreicher
Legenden aus der keltischen Mystik ist.
 Die Tafelrunde des König Artus fanden hier den Rahmen zu ihrem Schicksal und
ihrer Suche: ihr König Artus hatte ihnen zu Befehl gegeben den heiligen Gral
ausfindig zu machen, der in diesen Wäldern der „Kleinen Bretagne“
versteckt gewesen sein soll. Der Zauberer Merlin, als Freund und Berater des
jungen Artus, war einer der Ehrengäste im Wald von Brocéliande. Merlin
verliebte sich so sehr in Viviane, dass er für sie allein unter dem Teich, in
dem sich das Schloss von Comper spiegelte, eine Zitadelle aus reinem Kristall
erbaute. Die „Dame des Sees“, so wird sie auch genannt, zog Lancelot groß,
zukünftiger Ritter am Hofe Königs Artus. Trotz des Altersunterschiedes war
Vivianes Liebe zu Merlin, dem Zauberer, stark und ausschließlich und schon
bald war ihr das Irdische nicht mehr genug: die von Merlin erfahrenen
Zaubergeheimnisse dienten ihr dazu, den alten Druiden am Jungbrunnen zu verjüngen.
Danach sperrte sie ihren Geliebten für die Ewigkeit in neun felsenharte
Zauberkreise.
Die Tafelrunde des König Artus fanden hier den Rahmen zu ihrem Schicksal und
ihrer Suche: ihr König Artus hatte ihnen zu Befehl gegeben den heiligen Gral
ausfindig zu machen, der in diesen Wäldern der „Kleinen Bretagne“
versteckt gewesen sein soll. Der Zauberer Merlin, als Freund und Berater des
jungen Artus, war einer der Ehrengäste im Wald von Brocéliande. Merlin
verliebte sich so sehr in Viviane, dass er für sie allein unter dem Teich, in
dem sich das Schloss von Comper spiegelte, eine Zitadelle aus reinem Kristall
erbaute. Die „Dame des Sees“, so wird sie auch genannt, zog Lancelot groß,
zukünftiger Ritter am Hofe Königs Artus. Trotz des Altersunterschiedes war
Vivianes Liebe zu Merlin, dem Zauberer, stark und ausschließlich und schon
bald war ihr das Irdische nicht mehr genug: die von Merlin erfahrenen
Zaubergeheimnisse dienten ihr dazu, den alten Druiden am Jungbrunnen zu verjüngen.
Danach sperrte sie ihren Geliebten für die Ewigkeit in neun felsenharte
Zauberkreise.
Eine andere Artus-Legende erzählt, dass die Fee Morgane, die Halbschwester des König
Artus, im „Tal ohne Wiederkehr“ jene Ritter gefangen hielt, die weder ihr
noch den eigenen Ehefrauen treu waren. Eine ziemlich große Schar, die da
zusammenkam. Aber sie hatten es nicht schlecht. Essen, trinken, Lanzen
stechen, was eben ein Ritter so braucht. Nur die umgebenden Felsen hinderten
sie an der Flucht. Bis Sir Lancelot kam und der bösen
Fee zum Trotze all die unsittlichen Ritter befreite. Lancelot war eben der
treueste aller Ritter. Doch auch er war unsittlich: er war ehebrecherisch
treu. Beständig trieb er es mit keiner anderen, als immer nur mit der Gattin
seines Königs Artus.
Zu besichtigen:
·
Paimpont
Der
Ort liegt mitten im Wald, am Ufer eines von großen Bäumen umstandenen Sees.
Er verdankt seinen Ursprung einem Kloster, das hier vom 7. Jahrhundert bis zur
Französischen Revolution bestand.
·
Merlins Grab (Tombeau de Merlin)
·
Jungbrunnen (Fontaine de Jouvence)
·
Schloss Comper beherbergt heute das Artus-Museum. Im
Schlossteich soll Viviane, die Dame vom See, ihren Kristallpalast gehabt haben.
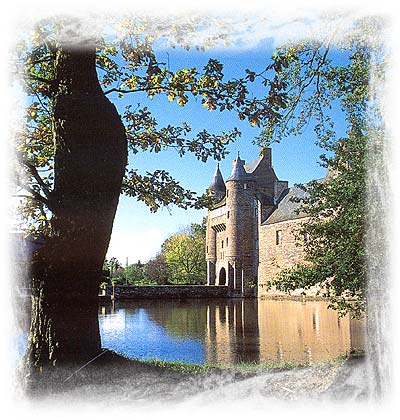
·
Tal ohne Wiederkehr (Val sans retour) -
kleine Fußwanderung
Das ist ein Felsenmeer in malerischer Umgebung. Man gelangt auf einem
unbefestigten Weg dorthin und erreicht zuerst einen 170 m hohen Felsen (Rocher
des Faux Amants). Hier hatte die Fee Morgane die Übeltäter zur Strafe
eingesperrt. Nach dem Tal ohne Wiederkehr kommt man an den Feenspiegel (Le
Miror aux Fées). Die Fee Morgane lebt hinter diesem Spiegel. Sie erscheint
immer wieder den Wanderern. Vorsicht ist also geboten!
·
Quelle von Barenton (Fontaine de Barenton) - kleine Fußwanderung
Sie wurde der Legende nach vom Herrn der Quelle, Sir
Askalon, bewacht. Ihr Wasser konnte – so erzählt die Sage - Stürme
entfesseln, wenn man es auf den "Perron de Merlin" - einen Stein in
der Nähe - schüttete.
·
Kapelle von Trehorenteuc
Der örtliche Pfarrer ließ die Kapelle von Trehorenteuc mit Malereien
ausstatten, die die Gralslegende zum Thema hatten. Die Spekulationen über den
Verbleib des Grals erhielten so neue Nahrung.
4.2 Vannes
Vannes
liegt am Golf von Morbihan. Der Name der Stadt stammt aus keltischer Zeit, als
Vannes die Hauptstadt der Veneter war. Mit seiner malerischen Altstadt
erinnert Vannes noch an das Mittelalter. Die alten Wehrmauern mit ihren drei
Rundtürmen und drei Toren sind mit bunten Gärten geschmückt. Die Kathedrale
"Saint-Pierre" aus dem 13. bis 16. Jahrhundert besitzt ein spätgotisches
Portal. Wenn man sich in einem der vielen Straßencafés befindet, verfällt
man nahezu in eine südfranzösische Urlaubsstimmung.
4.3 Erdeven/Carnac
Bei
Carnac befinden sich die beeindruckendsten Zeugnisse der Megalithkultur. Ganze
Felder sind bespickt mit diesen Zeugnissen aus der Jungsteinzeit (um etwa 3000
v. Chr.). Die Megalithkultur (griech.= Großsteinkultur) kennzeichnet Kulturen
vom skandinavischen bis zum iberischen Raum, die ihre Toten in großen
Steinkammern bestatteten. In der Bretagne befinden sich die meisten und
variationsreichsten megalithischen Baudenkmäler. Heute nimmt man an, dass die
Megalithbauten kultischen und religiösen Zwecken dienten, jedoch besteht hierüber
in der Wissenschaft bis heute Uneinigkeit.
Es
gibt Theorien über eine Verwendung als Kalender, als Prozessionsstraßen, als
Phallussymbole oder für astronomische Berechnungen. Durch ihr massives
Auftreten in dieser Region wurden sie ab dem 18. Jahrhundert mit bretonischen
Namen bzw. Kunstwörtern benannt.
Alignements von Kerzerho
Hier
liegt der Beginn des westlichen Flügels des Systems von Alignements um Carnac.
Dieses Feld liegt an der Straße von Erdeven nach Plouharnel, südlich von
Erdeven. Die Straße führt hindurch. Ursprünglich gab es hier auf einer
Strecke von 2 km ein Ensemble vom 65 m Breite mit tausenden Steinen. Durch den
Bau der Straße zwischen Plouharnel und Erdeven ist die Anlage jedoch schwer
beschädigt worden. Von Erdeven kommend, hat man rechts der Straße einige große
Menhire. Links gegenüber haben sich 10 Reihen in Ost-West-Orientierung und
eine ergänzende, nach Norden ausgerichtete Reihe erhalten.
Im Gegensatz zu den Feldern im östlichen Flügel sind diese Menhire nicht umzäunt
und man kann hindurchwandern. Dieses eindrucksvolle Erlebnis sollte man sich
nicht entgehen lassen. Die
Alignements zwischen Le Menec und Kerslescan hingegen wurden zum Schutz eingezäunt
und sind jetzt nur noch für kleine, geführte Besuchergruppen und die hier
weidenden Schafe zugänglich.
Alignement von Le Menec
Den
Beginn des östlichen Flügels der Alignements bei Carnac stellt das Feld von
Le Menec dar. Die Menhire werden von West nach Ost kleiner. Am westlichen Rand
gibt es ein Steingehege (Cromlec’h) von 90 x 70 Metern Ausdehnung, am östlichen
Rand gibt es die Reste eines Steinovals. Die Anlage umfasst 12 Reihen mit 116
Metern Breite im Westen und 63 Metern im Osten. Auf der Länge von 1165 Metern
stehen 1099 Menhire. Die Anlage weist einen Knick in der Ausrichtung auf, der
mit den Sonnenauf- und -untergängen zu den Sonnenwenden im Sommer und Winter
in Verbindung zu bringen ist.
Alignements von Kermario
Weiter
in östlicher Richtung schließen sich die langgestreckten Alignements von
Kermario an. Die Anlage zeigt in 10 bis 12 Reihen auf einer Länge von 1,2 km
982 Steine. Auch innerhalb dieses Feldes werden die Steine von West nach Ost
kleiner.
Inmitten des Feldes befindet sich ein Aussichtsturm aus napoleonischer Zeit,
von dem aus die Anlage recht gut zu überblicken ist.
Alignements von Kerlescan
Kerlescan
stellt nach den in einem Wäldchen befindlichen Reihen von Le Petit Menec den
nordöstlichen Abschluss der Anlagen des östlichen Flügels der Alignements
von Carnac dar. Es sind 13 Reihen vorhanden, die sich über 355 m Länge
erstrecken. Im Westen ist ein sehr schönes, nahezu quadratisches Steingehege
von 78 x 74 m Größe erhalten. Die Größe der Steine nimmt von West nach Ost
weiter ab.
Dolmen von Crucuno
Crucuno
liegt an der Straße zwischen Erdeven und Plouharnel, etwa 1 km nordöstlich
der Straße. Mitten im Dorf befindet sich direkt an einem Haus der Dolmen von
Crucuno. Es handelt sich um ein beeindruckendes Bauwerk mit großen
Tragsteinen und einer etwa 40 Tonnen schweren Deckplatte. Der Gang des Dolmens
wurde zerstört. Noch 1864 besaß die Anlage eine Länge von 27 Metern.
Dolmen von Mane-Groc’h
Durchquert
man Crucuno und lässt den Dolmen im Dorf hinter sich, gelangt man nach etwa 1
km zu einem unmittelbar links der Straße in einem kleinen Wald stehenden,
sehr schönen Dolmen. Dieser Dolmen von Mane-Groc’h zeigt einen Gang von 6
Metern Länge, der zu 4 symmetrisch zu beiden Seiten angeordneten Grabkammern
führt. Die Seitenkammern waren durch Steinplatten vom Gang abgetrennt. Einige
der Platten sind noch zu sehen.
Die Anlage ist nach Nordwesten ausgerichtet. Fünf Decksteine sind noch
vorhanden. Hinter dem Dolmen gab es noch ein kleines Steinkistengrab, dessen
Reste aber schwer zu erkennen sind.
Die
Halbinsel Quiberon ist eine der beliebtesten Urlaubsgegenden der Bretagne. Der
Golfstrom verleiht diesem Landstrich ein besonders mildes Klima, in dem sogar
Palmen gedeihen. Entlang der Halbinsel Quiberon erstreckt sich die "Côté
Sauvage", eine wildromantische Küste mit kleinen Badebuchten, umgeben
von zerklüfteten Felsformationen. Lohnenswert ist eine Fahrt auf der
Panoramastraße. Auf der etwa 6 km langen Strecke bieten sich immer wieder
eindrucksvolle Ansichten, zum Beispiel die Teufelsgrotte (Kroh en Diaoul) oder
das Felsentor (Port Blanc). Quiberon ist ein quirliger kleiner Fischerhafen
und Ausgangspunkt für Bootsausflüge zu den Inseln Houat, Hoedic und zur
Belle Ile. Sie ist die schönste, größte und bedeutendste der bretonischen
Inseln. Dementsprechend ist sie ein beliebtes Ausflugsziel.
Cromlec’h von St.-Pierre-Quiberon
Auf
der Halbinsel von Quiberon befindet sich kurz vor dem Ortsausgang von
St.-Pierre-Quiberon in Richtung Norden rechts der Durchfahrtsstraße ein
Cromlec’h (Steinkreis). Von der Straße aus ist der Cromlec’h nicht zu
sehen, die Anfahrt dorthin ist aber ausgeschildert.
Es handelt sich um einen recht großen, aber nur etwas weniger als zur Hälfte
erhaltenen Kreis aus Menhiren.
4.5 Locmariaquer
Das
berühmte neolithische Ensemble von Grand Menhir, Table des Marchand und Er
Grah in Locmariaquer ist dank der Ausschilderung gut zu finden. Es ist umzäunt
und man muss zur Besichtigung Eintritt bezahlen. Hier gibt es jedoch auch
reichlich Informationsmaterial zu den Megalithen der Bretagne (auch in deutsch
und englisch).
Die Anlagen stammen aus der Zeit von 4500 – 3500 v.d.Z. In dem umzäunten
Gebiet stehen auch noch sehr spärliche Reste eines Theaters aus römischer
Zeit.
Grand Menhir
Dieser
Menhir war über 20 Meter groß, aufgerichtet hat er über 18 Meter aus der
Erde geragt. Seine Masse beträgt ungefähr 280 Tonnen (nach anderen Schätzungen
350 Tonnen). Der Menhir ist bearbeitet worden. Er ist an seiner Basis geglättet
und das zweite Teil trägt eine stark verwitterte Gravur in Form eines Pfluges
oder Axt. Er wurde Ende des 5. Jahrtausends v.d.Z. errichtet. Der Menhir
besteht aus Orthogneis. Die Herkunft des Gesteins ist noch nicht exakt
bekannt, er stammt jedoch nicht von der Halbinsel Locmariaquer und muss also
über eine größere Distanz transportiert worden sein. Der Menhir ist in vier
Teile zerbrochen. Wann der Menhir zerbrochen ist, ist nicht bekannt. Bei
Ausgrabungen wurde auch die Verkeilungsgrube des Menhirs gefunden. Es zeigte
sich weiterhin, dass der Menhir nicht alleine stand, sondern auf einer Strecke
von 55 Metern in einer Reihe von 18 in Richtung Nordosten orientierter Steine.
Table des Marchand
Das Grab hat seinen Namen nach der Familie Marchand, auf
dessen Grund es stand. Später fügte man, um dem Namen einen scheinbaren Sinn
zu geben, ein –s an, so wurde aus dem Table des Marchand der Table des
Marchands, der "Tisch der Kaufleute" und entsprechend diesem Namen
deutete man den Ort als Treffpunkt von Kaufleuten. Diese Interpretation ist
inzwischen als gegenstandslos erkannt, aber sie und die falsche Bezeichnung
findet man noch in etlichen Beschreibungen. Der Cairn wurde schon zu römischer
Zeit zum großen Teil abgerissen, so dass sich das Monument lange Zeit als
tischförmiger Dolmen (daher auch der Name) präsentierte. Um die Gravuren auf
einem Tragstein und der Deckplatte zu schützen, wurde der Dolmen in jüngerere
Zeit von einem künstlichen Cairn abgedeckt.
Tumulus (Cairn) von Er Grah
Das gesamte Bauwerk weist eine Länge von 140 Metern auf. Ein in Nord-Süd-Richtung
langgestreckter Tumulus bedeckt eine geschlossene Grabkammer, zu der kein Gang
führte. Ein Zugang zu dem Grab ist nach Beendigung des Cairns also nicht mehr
möglich gewesen. Die beiden Seitenwände wurden in der Längserstreckung in
zwei nach Süden ausgerichteten „Armen“ fortgesetzt. Während der
eigentliche Tumulus aus Steinen errichtet wurde, befanden sich zwischen den
Armen keine Steine. Die Höhe des Bauwerks ist nicht sehr bedeutend gewesen.
Vielleicht war die heute sichtbare Platte der Grabkammer auch schon immer
sichtbar. Diese Platte verbindet das Bauwerk mit dem Grand Menhir.
Dolmen von Pierres Plates
Der Dolmen befindet sich südwestlich von Locmariaquer, direkt an der Küste.
Es handelt sich um einen außerordentlich schönen, 24 m langen Dolmen, der
einen um 120 Grad geknickten Gang und ein Seitenkabinett aufweist. Am Ende
zeigt sich eine sich etwas verbreiternde Kammer mit einer Trennplatte. Pierres
Plates ist berühmt für seine Gravuren, die am Eingang beginnen und sich auf
den Tragsteinen den ganzen Dolmen entlangziehen. Es handelt sich um komplexe
Symbole, die wahrscheinlich Muttergottheiten (Fruchtbarkeitsgöttinnen), zum
Teil mit vervielfachten Brüsten, darstellen.
Drei fehlende Decksteine sind zum Schutz des Dolmens und der Gravuren, und um
den ursprünglichen Eindruck wieder zu erzeugen, ergänzt worden. Diese neuen
Platten sind durch die modernen Bearbeitungsspuren gut erkennbar, auch ist auf
der neben dem Dolmen aufgestellten Informationstafel zu sehen, welche
Deckplatten original sind.
Auf
unserem Weg gelangen wir zu einem der bedeutendsten Fischereihäfen der
Bretagne, Concarneau. Im Hafenbecken liegt die kleine befestigte und
vielbesuchte Inselstadt Ville Close, die von einem Stadtmauerring umgeben ist.
Die im 14. Jahrhundert errichtete Befestigung wurde nach ihrer Zerstörung im
2. Weltkrieg originalgetreu wiederaufgebaut. Im Sommer drängeln sich
zahlreiche Besucher durch das Stadttor in die beiden Straßenzüge.
Von Ostern bis September (tägl. von 9 bis 19 Uhr, geringer Eintritt) kann man
einen Stadtmauerrundgang machen. Das eigentliche Leben in der Fischerstadt
Concarneau findet allerdings außerhalb der Mauern statt. In den vielen
Hafenabschnitten ist immer viel Betrieb. Von montags bis donnerstags jeweils
von 7 - 12 Uhr findet in den angrenzenden Hallen die Fischversteigerung (La
Criée) statt.
 Der
„umfriedete Pfarrbezirk“ (Enclos Paroissial) ist die Bezeichnung für das
gesamte Ensemble, bestehend aus Kirche, Pforte, Umfassungsmauer, dem Beinhaus
und dem Calvaire. Ein Enclos stellte im Mittelalter das Zentrum des Dorfes
dar. Die umfriedeten Pfarrbezirke waren das Statussymbol eines jeden Dorfes.
Einige dieser Dörfer standen wegen ihrer sehenswerten Calvaire in ständigem
Wettstreit miteinander. Als Baumaterial verwendete man größtenteils Granit.
Der Kalvarienberg (Calvaire) ist das interessanteste Element eines
Pfarrbezirks. Gedacht war der Calvaire als Bilderbibel für das einfache Volk.
Ein Calvaire erzählt sehr eindrucksvoll den Lebens- und Leidensweg Christi.
Der
„umfriedete Pfarrbezirk“ (Enclos Paroissial) ist die Bezeichnung für das
gesamte Ensemble, bestehend aus Kirche, Pforte, Umfassungsmauer, dem Beinhaus
und dem Calvaire. Ein Enclos stellte im Mittelalter das Zentrum des Dorfes
dar. Die umfriedeten Pfarrbezirke waren das Statussymbol eines jeden Dorfes.
Einige dieser Dörfer standen wegen ihrer sehenswerten Calvaire in ständigem
Wettstreit miteinander. Als Baumaterial verwendete man größtenteils Granit.
Der Kalvarienberg (Calvaire) ist das interessanteste Element eines
Pfarrbezirks. Gedacht war der Calvaire als Bilderbibel für das einfache Volk.
Ein Calvaire erzählt sehr eindrucksvoll den Lebens- und Leidensweg Christi.
Hier
wird von Maria Verkündung bis zur Auferstehung das Leben Jesu in 27 Episoden
erzählt. An den vier Ecken befinden sich die Evangelisten, begleitet von
ihren Wahrzeichen; Lucas von einem Ochsen, Mathäus von einem Engel, Markus
von einem Löwen und Johannes von einem Adler.
Ploumanac'h
ist ein kleiner Fischerort in einer sehr reizvollen Landschaft. Selbst in der
Hauptsaison empfindet man diesen Ort als nicht überfüllt. Zwischen
Ploumanac'h und Trégastel erstreckt sich die "Corniche bretonne".
Es ist die Küste der rosa Granitfelsen, die vor allem bei der Abenddämmerung
imposante Lichtspiele und Landschaftsbilder zeigt. Auf dem ehemaligen Pfad der
Zöllner, der zum Leuchtturm führt, kann man die riesigen Steinbrocken in
aller Ruhe bewundern. Hier liegen die Steinkolosse,
die Namen wie "Hase", "Teufelsschloss" oder "Schildkröte"
tragen. Der Bucht gegenüber thront auf einer Klippeninsel Schloss Costaères.
Es entstand 1892 im Auftrag des polnischen Ingenieurs Bruno Abdank Abakanovicz,
der die Insel von einem hier Kartoffeln züchtenden Perroser Zöllner erworben
hatte. Das Schloss wurde bald Treffpunkt einer illustren Gästeschar aus Künstlern
und Schriftstellern. Henryk Sienkiewicz soll hier seinen Roman »Quo
vadis« geschrieben haben, für den er 1905 den Nobelpreis erhielt.
1989 kaufte der Kabarettist Didi Hallevorden das Schloss als Feriensitz. Der
4,4 km lange Zöllnerpfad
beginnt am geschützten Hafen von Ploumanac´h, säumt den Strand, umrundet
die Halbinsel und führt am Leutturm „Min
Ru“ vorbei. Hinter dem Leuchtturm durchläuft der markierte Küstenweg
eine Heidenlandschaft. Er endet am Strand von Trestraou mit dem Kalvarienberg
aus dem 17. Jh.
 Bei
Ebbe ragt die kleine, überdachte Andachtsstätte, dem Heiligen St.-Guirec
geweiht, aus dem ruhigen Wasser der Bucht von Ploumanac´h. Vor über 1400
Jahren ist angeblich der hochverehrte englische Mönch hier an Land gegangen,
um die Heiden zu missionieren. Zum Gedenken an ihn wurde im 12. Jh. ein mit
seinem hölzernen Standbild versehenes Oratorium (bezeichnete ursprünglich
den Ort der Zusammmenkunft zum Gebet) errichtet, das bei Flut bis zu den Säulen
verschwindet und nur bei Ebbe über den Strand zu Fuß zu erreichen ist. Um
die Gedenkstätte des St.-Guirec entwickelte sich im Laufe der Zeit ein
Brauch, der die jungen Damen des Ortes anzog: es sollte dem Mädchen, das der
Holzfigur des Heiligen mit einer Nadel in die Nase stach, noch im selben Jahr
ein gut aussehender Bräutigam begegnen. Die geplagte Holzskulptur wurde vor
Jahren durch eine Granitskulptur ersetzt, die aber in der Nasengegend schon
wieder deutliche Spuren der Verwüstung zeigt.
Bei
Ebbe ragt die kleine, überdachte Andachtsstätte, dem Heiligen St.-Guirec
geweiht, aus dem ruhigen Wasser der Bucht von Ploumanac´h. Vor über 1400
Jahren ist angeblich der hochverehrte englische Mönch hier an Land gegangen,
um die Heiden zu missionieren. Zum Gedenken an ihn wurde im 12. Jh. ein mit
seinem hölzernen Standbild versehenes Oratorium (bezeichnete ursprünglich
den Ort der Zusammmenkunft zum Gebet) errichtet, das bei Flut bis zu den Säulen
verschwindet und nur bei Ebbe über den Strand zu Fuß zu erreichen ist. Um
die Gedenkstätte des St.-Guirec entwickelte sich im Laufe der Zeit ein
Brauch, der die jungen Damen des Ortes anzog: es sollte dem Mädchen, das der
Holzfigur des Heiligen mit einer Nadel in die Nase stach, noch im selben Jahr
ein gut aussehender Bräutigam begegnen. Die geplagte Holzskulptur wurde vor
Jahren durch eine Granitskulptur ersetzt, die aber in der Nasengegend schon
wieder deutliche Spuren der Verwüstung zeigt.
Trégastel
liegt am wohl schönsten Abschnitt dieses Küstenstreifens. Auch hier findet
man diese seltsam geformten Felsen aus rot leuchtendem Granit. Auf der
Landzunge befinden sich etliche Buchten und Strände, die auch in den
Sommermonaten angenehm leer sind.
Der
eigentliche Ferienort, von den 2000 Einwohnern als Ste.–Anne bezeichnet,
liegt um den kleinen Hafen Coz–Pors, der ältere Ortsteil Le Bourg landeinwärts
auf einem Hügel.
In Felsgrotten aus rosa Granit präsentiert das „Aquarium Marin“ in 26 Bassins die bretonische Unterwasserwelt:
Seesterne, Anemonen, Krebse und vieles an Fischen. Enorm detailgetreu zeigt
ein 30 m² großes Modell einen Ausschnitt der Granitküste und die
Auswirkungen der Gezeiten auf die Natur.
Öffnungszeiten
des Aquariums: Mai–Juni tgl. außer Montag 10–18 Uhr, Montag 14-18 Uhr
„Aquarium Marin“
Trégastel, Boulevard du Coz–Pors, Eintritt 7€
70
Meter über dem Meeresspiegel erstreckt sich die Steilküste des Cap Fréhel,
auf der sich ein Pflanzen- und Vogelschutzgebiet befindet. Imponierend ist der
gewaltige Felsen "Grande Faucounière", ein Nistplatz für die
verschiedensten Seevögel. Um die Ruhe am Cap genießen zu können oder die Seevögel
zu beobachten, sollte man die frühen Morgenstunden wählen. Bereits zur Zeit
der Römer wiesen Leuchtfeuer den Weg durch die Klippen und Riffe des Ärmelkanals.
1821 wurde der Turm mit der neuesten Technologie des französischen Physikers
und Wellenforschers Fresnel ausgestattet: Drehbare Parabollinsen reflektierten
das Licht der Rapsöllaternen, das erste Interwall– Rotationsfeuer war
erfunden.
Parken: gebührenpflichtiger Parkplatz vor dem neuen Leuchtturm. Von hier
aus führen Trampelpfade an einem Aussichtscafe–Restaurant vorbei zur
Capspitze.
Auf dem Wanderweg GR34 kann man den Küstenabschnitt bis "Fort la
Latte", einer mittelalterliche Festung aus dem 11. und 12. Jahrhundert,
umwandern.
 Fort la Latte
Fort la Latte
An drei Seiten von Wasser umgeben, thront die mittelalterliche Festung auf
einer schmalen Felseninsel am Eingang der Baye de la Fresnaye. Bereits im 10.
Jh. soll hier eine erste Burg gestanden haben. Der heutige Bau geht auf eine im
13. Jh. von den Herren Goyon–Matignon erbaute Anlage zurück. Die Burg wird in
14. Jh. mehrmals erweitert, von Bertrand Duguesclin eingenommen, wieder zurückgegeben
und schließlich 1421 von der Familie Goyon verlassen. Unter Louis XIV wird die
Burg zu einer Festung ausgebaut (Baumeister Vauban). In den hohen Mauern standen
Kanonenbatterien, in den Bergfried zogen die Wachen ein, die die Schiffe aus
St.–Malo vor Angriffen der Holländer und Engländer schützen sollten.
Seit 1931 ist die Burg in Privatbesitz und kann zum Teil besichtig werden.
Besonders aufregend ist der Blick vom Donjon, dem höchsten Wachturm hinüber
auf das Cap Fréhel und über die Bucht von Fresnaye.
6.2
Dinan
Man sagt,
es sei die schönste Stadt der Bretagne. Ein unerlässlicher Programmpunkt also
ist es, Dinan zu besuchen. Die malerische Stadt aus dem Mittelalter liegt auf
einem etwa 70 m hohen Felsplateau über dem Rance-Fluss. Die Altstadt mit ihren
alten Fachwerkhäusern gruppiert sich um die "Place des Merciers" und
zieht sich bis zum Rance-Ufer hinunter. Sie ist von einem Wehrmauerring mit
alten Türmen und Toren umschlossen. In den alten Häusern wohnen Handwerker und
Künstler, die ihre Ware ausstellen und verkaufen. Teilweise kann man ihnen bei
der Arbeit zuschauen.
6.3 Menhir von
Champ-Dolent,
Dol de Bretagne
Man verläßt
die von Dol de Bretagne nach Süden führende Straße D795 in dem kleinen Ort
Champ-Dolent nach Osten und stößt hier auf den gewaltigen, etwa 9,50 Meter
hohen Menhir. Er ist neben dem von Kerloas bei Plouarzel, Finistere, einer der
größten der Bretagne. Der Menhir besteht aus Granit und muss über mindesten 4
km Entfernung transportiert worden sein. Seine Oberfläche wurde sorgfältig
geglättet. An seinem Fuß befindet sich ein großer, dunkler Doleritblock zu
Verkeilung. Vielleicht hat dieser Block auch eine religiöse Funktion gehabt.
Wer die Bretagne besucht, sollte sich dieses beeindruckende megalithische
Monument nicht entgehen lassen.
6.4 Mont St.-Michel
Wahrscheinlich
war der Mont-Saint-Michel schon im 6. Jahrhundert von Mönchen bewohnt. Eine der
zahlreichen Legenden besagt, dass im Jahr 704 der Erzengel Michael dem
Erzbischof von Avranches im Traum erschien und ihn aufforderte, eine Kapelle auf
dem Gipfel des Mont Tombe (Berg des Grabes) zu errichten. Aus der Kapelle wurde
eine Stiftskirche mit 12 Kapitularen.  Zu dieser Zeit wurde durch eine
Flutkatastrophe der Mont vom Festland abgetrennt und zur Insel. Gleichzeitig
wurde der Forêt de Sissy, ein riesiges Waldgebiet zerstört, das einst von
Avranches bis nach Dinan reichte.
Zu dieser Zeit wurde durch eine
Flutkatastrophe der Mont vom Festland abgetrennt und zur Insel. Gleichzeitig
wurde der Forêt de Sissy, ein riesiges Waldgebiet zerstört, das einst von
Avranches bis nach Dinan reichte.
Nachdem im 10. Jahrhundert die Normannen zum Katholizismus konvertiert waren und
dafür vom französischen König das Herzogtum Normandie zugesprochen bekamen,
stiftete Richard I. im Jahr 966 eine Abtei, die 30 Benediktinermönchen ein
Zuhause bot. Die Abtei entwickelte sich zu einem kulturellen und
wirtschaftlichen Zentrum und besaß große Besitztümer.
Im Jahr 1023 wurde mit dem Bau einer größeren Abtei begonnen. Seit dem Beginn
der Normannenüberfälle entstand um die Abtei eine befestigte Siedlung. Im 13.
Jahrhundert stellte das gotische Bauwerk in schwindelerregender Höhe ein
absolutes Wunder dar. Die abermaligen Erweiterungspläne konnten dann durch den
beginnenden Hundertjährigen Krieg mit England nicht realisiert werden. Der
Mont-Saint-Michel wurde 1254 zur königlichen Festung erklärt und blieb während
des gesamten Krieges stets französisch.
Der damalige Abt Robert de Thurigny, einer der geschicktesten Diplomaten seiner
Zeit, versuchte sich erfolglos in der Vermittlung. Statt eines Klosteranbaus
wurden blitzartig Wehranlagen errichtet - mit dem Erfolg, dass der Mont auch in
der Folgezeit niemals eingenommen werden konnte.
Während der Religionskriege begann der Verfall des Mont St. Michel; ein Abt
brannte mit der Klosterkasse durch, das Kloster geriet immer mehr in einen
desolaten Zustand. Im 17. Jahrhundert übernahm der Mauristenorden den Mont, den
er reformieren sollte. Aber auch er bewies wenig Geschick. In der französischen
Revolution wurde der Berg säkularisiert und zum Gefängnis umfunktioniert, was
er bis 1863 auch blieb. 1874 wurde er zum schützenswerten historischen Monument
erklärt, restauriert und gewann wieder an Bedeutung. Seit 1966 leben wieder Mönche
auf dem Mont St. Michel.
Seit einigen Jahren ist
der Mont vom Verlanden bedroht. Die zwei Kilometer lange Deichstraße, die vor
120 Jahren gebaut wurde, verhindert, dass u.a. die Schlickablagerungen, die der
Cousnon heranträgt, ihren Weg ins Meer finden. Jährlich werden außerdem mehr
als eine Million Kubikmeter Sand in der Bucht angeschwemmt, die durch den Straßendamm
an Ort und Stelle gehalten werden. Die Sand- und Schlickschicht um die Insel ist
inzwischen 15 Meter hoch. Man will nun den Damm durch eine Brückenkonstruktion
auf Stelzen ersetzen.
Sehenswürdigkeiten:
Abteikirche
Das große Problem beim Bau der Kirche
war die Form des Untergrundes: Der Mont St. Michel ist immerhin ein relativ
spitz nach oben laufender Berg - und die Kirche, die heute dort oben steht ist
hundert Meter lang. Es galt also, einen Untergrund zu schaffen, der groß und
stabil genug ist, eine Kirche und Räume für Mönche und Besucher zu tragen.
Hier ist deutlich die Entwicklung von
der Romanik bis zur Spätgotik erkennbar. Die Kirche wurde 1022 begonnen und war
ursprünglich um drei Jochbögen länger. Das Haupt- und das Querschiff sind in
frühromanischem Stil gestaltet. Das Hauptschiff wurde nach der Eroberung durch
die Normannen (William - 1066) vollendet und diente als Abteikirche der
englischen Könige. Die Kirche ruht auf drei Krypten, diese wiederum auf den
Mauern der ebenfalls zur Krypta umgewandelten alten karolingischen Kirche (Notre-Dame-sous-Terre)
aus dem 10. Jahrhundert.
Die ursprüngliche Felsspitze liegt
genau unter der Vierung. Das Lang- und Querschiff mussten durch drei Krypten
untermauert werden. Der spätgotische Chor (1446 - bis 1521 erbaut) hatte einen
romanischen Vorläufer, der eingestürzt ist.
Klosterkomplex
Die dreistöckige "Merveille"
(Das Wunder) entstand zwischen 1211 und 1228, finanziert von den französischen
Königen. Der Klosterbau liegt an der Nordseite und dient quasi als Unterbau der
Abteikirche.
Im Erdgeschoss befinden sich der
Vorratskeller und der Almosenraum, der früher als Herberge sowohl für Pilger
als auch für Bettler diente. Heute befindet sich dort ein
Devotionalienverkaufsraum (Postkarten etc...). Außerdem ist dort der Mont im
Modell zu sehen. Diese Etage beherbergt auch den Kerker.
Im 1. Stock befindet sich der Salle
des Chevaliers - der vierschiffige Rittersaal, der das Arbeitszimmer der Mönche
war. Dies war der einzig beheizbare Raum der Abtei. Der Raum konnte durch
Wandteppiche aufgeteilt werden. Daneben liegt der Salle d'hôtel - das
Gastzimmer, ein sehr eleganter Raum, der auf Säulen ruht und mit Tapeten und
Wandbehängen und einem bemalten Gewölbe geschmückt war. In dem 35 Meter
langen Saal wurden die Gäste vom Abt empfangen und verköstigt. Ebenfalls in
dem Raum befinden sich zwei Kamine, an denen gekocht wurde, und die Latrinen.
Im 2. Stock befindet sich der 1228
gebaute Kreuzgang. Normalerweise befand sich der Kreuzgang bei den Benediktinern
im Zentrum des Klosters. Wegen der besonderen Verhältnisse am Mont ist es
erstaunlich, dass überhaupt noch ein Kreuzgang aufgesetzt werden konnte. Das größte
Problem stellt das Gewicht des Baumaterials dar. Gleichzeitig ist der Kreuzgang
durch seine Lage Stürmen besonders ausgesetzt. Aus diesem Grund besitzt er ein
leichtes Holzdach, das auf zierlichen Doppelsäulen aus rotem Granit ruht,
Kapitelle fehlen.
In
der Westarkade befindet sich eine große Öffnung, die für einen
Erweiterungsbau ausgespart wurde. An der Südwand ist der Kreuzgang durch ein
Brunnenhaus unterbrochen, dort sind Stufensitze eingelassen, die bei der Fußwaschung
der Mönche durch ihren Abt dienten. Über dem Gastzimmer befindet sich das
Refektorium, das in Fastenzeiten als Speiseraum diente. Der Raum wird durch 59
Fenster indirekt erhellt.
Der Mont besaß einen einzigen Zugang,
die Porte de l'avancée, der zudem doppelt abgesichert war. Rechts davon,
im Maison de l'arcade waren die Soldaten kaserniert.
Auf der landabgewandten Seite befinden
sich die Abteigärten. Außerdem besitzt der Mont im Musée historique
eine Wachsfigurensammlung zur Geschichte des Klosters und eine Muschelsammlung.
6.5
Cancale
Die Straße D155 führt uns nach Cancale, direkt
neben dem Deich an der Austernbucht entlang. Überall werden die berühmten
Huitres de Cancale angeboten. Kilometerlange Muschelzäune staken bei Ebbe aus
der extrem flachen Baie de Mont St. Michel, die Kutter liegen im Schlick. Wer
noch nicht zu den Feinschmeckern gehört, kann sich bei einer Dégustation, zu
der frisch geöffnete Austern mit Zitrone gereicht werden, von der lebenden
Kostbarkeit überzeugen lassen.
Direkt bei Cancale beginnt
die bizarre Smaragdküste, die sich über 120 km bis zum Cap Fréhel erstreckt.
6.6 Saint-Malo
Ursprung
der Stadt, war die gallo-römische Siedlung Aleth,
die auf einer Halbinsel, dem heutigen Stadtteil St.-Servan vorgelagert war. Lange schützte die strategisch günstige
Lage die Bewohner vor Eindringlingen. Im 6. Jahrhundert begann der walisische Mönch
Maklou, dessen Name im Französischen
zu Malo wurde, mit der
Missionierung der Einwohner.
Allmählich begann die Siedlung zu wachsen und sich auf das benachbarte Festland
auszudehnen. Der Schutzheilige und damit Namensgeber des neuen Stadtteiles wurde
der Heilige Servan. Im 12.Jh. verstärkte sich der Druck auf die Siedlung durch
Überfälle der Normannen immer mehr. Die nördlich gelegene Insel, heute "Intra
muros", schien den nötigen Schutz zu bieten. 1142 siedelte auch der
Bischof auf die Insel und errichtete dort einen Dom. In den folgenden Jahren
begann der Bau einer mächtigen Wehrmauer, die der Stadt, jetzt Saint-Malo genannt, lange Zeit Sicherheit und Unabhängigkeit bot.
Seine Blütezeit erreichte Saint-Malo im 16. Jahrhundert. Durch Fischfang und
Handel erlangte Saint-Malo Wohlstand. 1590 wurde gar eine eigene Republik
ausgerufen. Gefürchtet war Saint-Malo bei holländischen und englischen
Handelsschiffen, war die Stadt doch die Heimat wilder Korsaren, allen voran
Robert Surcouf, der mit seinem schnellen und wendigen Schiff "Renard"
(Fuchs) auf Beutezug ging. Er war dabei so erfolgreich, dass er sich mit 35
Jahren zur Ruhe setzen konnte.
Im August 1944, nach der Landung der Alliierten in der Normandie, wurde
Saint-Malo zu etwa 75% durch einen Brand zerstört. Im Gegensatz zu anderen
stark zerstörten Städten bemühte sich Saint-Malo aber um einen möglichst
originalgetreuen Wiederaufbau, der auch sehr gut gelang. Man stützte sich dazu
auf alte Pläne und Abbildungen der Stadt.
6.7 Vitré
Die
imposante Burg stammt in ihren Grundzügen noch aus dem Mittelalter. Als
Paradebeispiel damaliger Militärarchitektur wurde sie wieder tiptop
restauriert. Vom Donjon wird die strategisch günstige Lage auf dem Sporn und
der Verlauf der Stadtmauer besonders deutlich. Entlang der damaligen Grenzen
errichteten die bretonischen Herzöge mehrere solcher Festungsbauten, um sich
vor den Machteinflüssen französischer Könige zu schützen. Zusammen mit Fougères
im Norden und Châteaubriant im Süden entstanden wirksame Grenzbastionen nach
Osten. 700 Jahre lang konnte sich das kleine Volk im Westzipfel seine Unabhängigkeit
bewahren, bis schließlich eine geschickte Heiratspolitik siegte. König Franz
I. von Frankreich vermählte sich laut Vertrag mit der bretonischen Herzogin
Claude und konnte so die Bretagne 1532 der französischen Krone unterstellen.
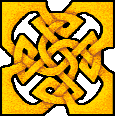
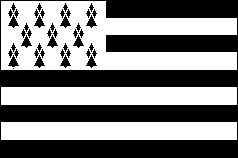 Die
Bretagne ist mit knapp 34.100 km2 Frankreichs größte Halbinsel.
Sie ist in 4 Départements aufgegliedert: Morbihan (56), Finistère (29), Côtes
d’Armor (22) und die Ille-et-Vilaine (35). Die Küstenlinie beträgt etwa
3000 Km. Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne. Die höchste Erhebung ist der
Roc Trevezel mit 384 m. Bis 1964 gehörte das Département „Loire-Atlantique“ mit der Hauptstadt Nantes ebenfalls zur Bretagne, welches seitdem der Nachbarregion
„Pays de la Loire“ angehört.
Die
Bretagne ist mit knapp 34.100 km2 Frankreichs größte Halbinsel.
Sie ist in 4 Départements aufgegliedert: Morbihan (56), Finistère (29), Côtes
d’Armor (22) und die Ille-et-Vilaine (35). Die Küstenlinie beträgt etwa
3000 Km. Rennes ist die Hauptstadt der Bretagne. Die höchste Erhebung ist der
Roc Trevezel mit 384 m. Bis 1964 gehörte das Département „Loire-Atlantique“ mit der Hauptstadt Nantes ebenfalls zur Bretagne, welches seitdem der Nachbarregion
„Pays de la Loire“ angehört.
 Die sogenannte „Gallorömische Epoche“ beginnt 58 v.Chr. mit
der Eroberung Galliens durch Cäsar. Ganz Galliens??...nein, wir wissen: Ein
Stamm leistete hartnäckig Widerstand - es waren die Veneter, die am Golf von
Morbihan lebten, von dort aus den Zinnhandel mit England kontrollierten, und
die die führende Seemacht Armoricas in dieser Zeit waren. Brutus gelang 56
v.Chr. mit seiner Flotte endlich die Niederschlagung der Veneter. Damit war
ganz Gallien in römischer Hand. Die Bretagne wurde als
Die sogenannte „Gallorömische Epoche“ beginnt 58 v.Chr. mit
der Eroberung Galliens durch Cäsar. Ganz Galliens??...nein, wir wissen: Ein
Stamm leistete hartnäckig Widerstand - es waren die Veneter, die am Golf von
Morbihan lebten, von dort aus den Zinnhandel mit England kontrollierten, und
die die führende Seemacht Armoricas in dieser Zeit waren. Brutus gelang 56
v.Chr. mit seiner Flotte endlich die Niederschlagung der Veneter. Damit war
ganz Gallien in römischer Hand. Die Bretagne wurde als  Damit war der Anschluss der Bretagne an Frankreich
besiegelt.
Damit war der Anschluss der Bretagne an Frankreich
besiegelt. Der Bau
wurde 1811 unter
Der Bau
wurde 1811 unter  Die Tafelrunde des König Artus fanden hier den Rahmen zu ihrem Schicksal und
ihrer Suche: ihr König Artus hatte ihnen zu Befehl gegeben den heiligen Gral
ausfindig zu machen, der in diesen Wäldern der „Kleinen Bretagne“
versteckt gewesen sein soll. Der Zauberer Merlin, als Freund und Berater des
jungen Artus, war einer der Ehrengäste im Wald von Brocéliande. Merlin
verliebte sich so sehr in Viviane, dass er für sie allein unter dem Teich, in
dem sich das Schloss von Comper spiegelte, eine
Die Tafelrunde des König Artus fanden hier den Rahmen zu ihrem Schicksal und
ihrer Suche: ihr König Artus hatte ihnen zu Befehl gegeben den heiligen Gral
ausfindig zu machen, der in diesen Wäldern der „Kleinen Bretagne“
versteckt gewesen sein soll. Der Zauberer Merlin, als Freund und Berater des
jungen Artus, war einer der Ehrengäste im Wald von Brocéliande. Merlin
verliebte sich so sehr in Viviane, dass er für sie allein unter dem Teich, in
dem sich das Schloss von Comper spiegelte, eine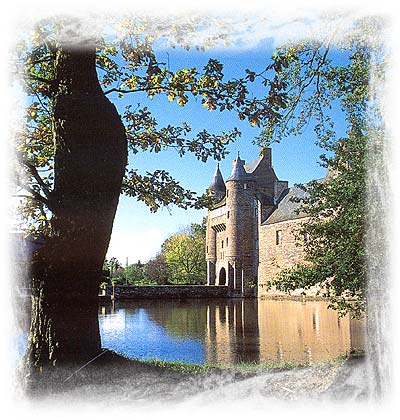
 Der
„umfriedete Pfarrbezirk“ (Enclos Paroissial) ist die Bezeichnung für das
gesamte Ensemble, bestehend aus Kirche, Pforte, Umfassungsmauer, dem Beinhaus
und dem Calvaire. Ein Enclos stellte im Mittelalter das Zentrum des Dorfes
dar. Die umfriedeten Pfarrbezirke waren das Statussymbol eines jeden Dorfes.
Einige dieser Dörfer standen wegen ihrer sehenswerten Calvaire in ständigem
Wettstreit miteinander. Als Baumaterial verwendete man größtenteils Granit.
Der Kalvarienberg (Calvaire) ist das interessanteste Element eines
Pfarrbezirks. Gedacht war der Calvaire als Bilderbibel für das einfache Volk.
Ein Calvaire erzählt sehr eindrucksvoll den Lebens- und Leidensweg Christi.
Der
„umfriedete Pfarrbezirk“ (Enclos Paroissial) ist die Bezeichnung für das
gesamte Ensemble, bestehend aus Kirche, Pforte, Umfassungsmauer, dem Beinhaus
und dem Calvaire. Ein Enclos stellte im Mittelalter das Zentrum des Dorfes
dar. Die umfriedeten Pfarrbezirke waren das Statussymbol eines jeden Dorfes.
Einige dieser Dörfer standen wegen ihrer sehenswerten Calvaire in ständigem
Wettstreit miteinander. Als Baumaterial verwendete man größtenteils Granit.
Der Kalvarienberg (Calvaire) ist das interessanteste Element eines
Pfarrbezirks. Gedacht war der Calvaire als Bilderbibel für das einfache Volk.
Ein Calvaire erzählt sehr eindrucksvoll den Lebens- und Leidensweg Christi. Bei
Ebbe ragt die kleine, überdachte Andachtsstätte, dem Heiligen
Bei
Ebbe ragt die kleine, überdachte Andachtsstätte, dem Heiligen  Fort la Latte
Fort la Latte Zu dieser Zeit wurde durch eine
Flutkatastrophe der Mont vom Festland abgetrennt und zur Insel. Gleichzeitig
wurde der Forêt de Sissy, ein riesiges Waldgebiet zerstört, das einst von
Avranches bis nach Dinan reichte.
Zu dieser Zeit wurde durch eine
Flutkatastrophe der Mont vom Festland abgetrennt und zur Insel. Gleichzeitig
wurde der Forêt de Sissy, ein riesiges Waldgebiet zerstört, das einst von
Avranches bis nach Dinan reichte.